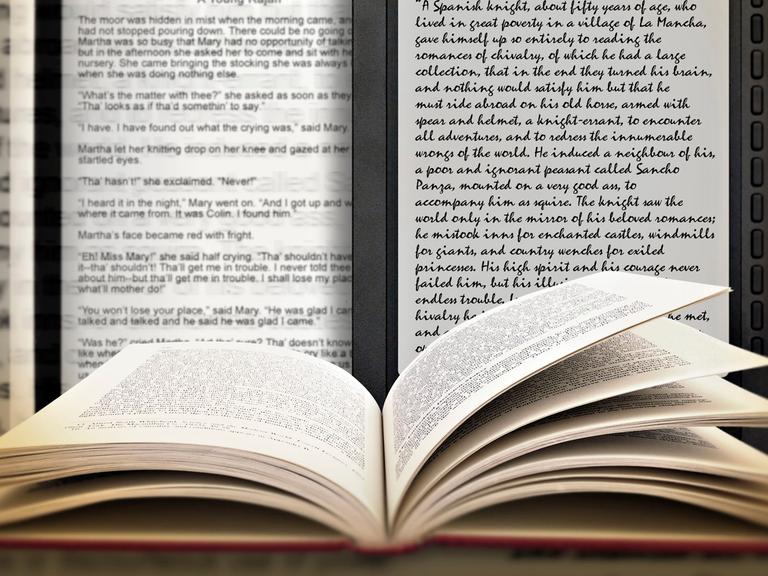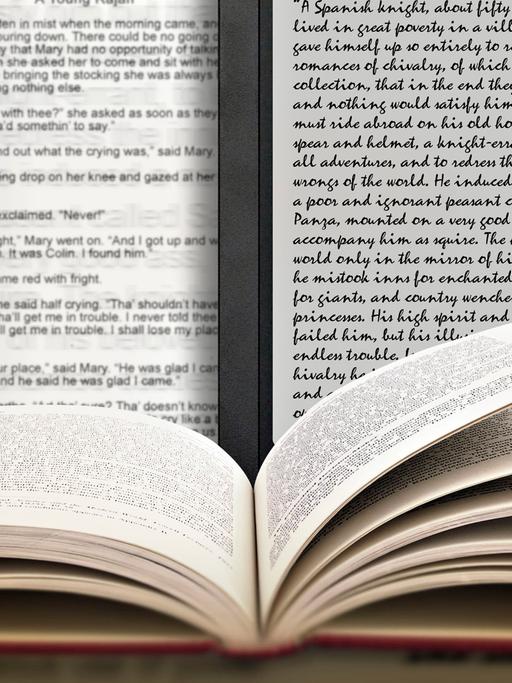Abgründe des Literaturbetriebs

Von Edelgard Abenstein · 27.05.2015
In "Tod in Turin" erzählt Jan Brandt die Geschichte eines Schriftstellers, der von Deutschland nach Italien reist, um sich neu zu erfinden. Brandts neuer Roman ist eine Satire über den Literaturbetrieb und zugleich Dokument einer Selbstfindung.
Der zweite Roman ist immer der schwerste, heißt es in der Verlagsbranche. Vor allem, wenn der erste ein Erfolg war, wie im Falle Jan Brandts. Der 1974 geborene Autor war 2011 mit seinem Debüt "Gegen die Welt" für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das knapp tausendseitige Epos handelt vom Erwachsenwerden, von Popkultur und Wendezeit in Ostfriesland.
"Tod in Turin" bedient ein anderes Genre. Ähnlich einem Reisebericht schildert der Autor, wie er nach diesem Erfolg ein paar Monate lang durch die Republik zog, Interviews gab, mehr als 60 Lesungen absolvierte und schließlich auf der Buchmesse in Turin landete.
Weil sein neuer Roman, eine jahrhundertumspannende, deutsch-amerikanische Auswanderergeschichte, nicht gelingen mag, kommt ihm die Reise gerade recht.
In Klarnamen - manche Namen sind geschwärzt - erzählt er, wen er alles auf welchen Partys kennenlernt, Kollegen, Verleger, Kritiker. Er berichtet von der Konkurrenz hinter den Kulissen, vom Dauerlauf um die noch so kleinen Buchpreise, von Häppchen und One-Night-Stands, von den ewig-gleichen Killer-Fragen nach der Biografie bei Lesungen und von Kritikern, die unumwunden zugeben, dass sie die Bücher, nach denen sie fragen, gar nicht gelesen haben. Das ist nicht neu, aber durchaus amüsant zu lesen.
Weniger interessant ist die Fußnotenmanie, mit der Brandt jedes Detail festhält, welche Nummer sein Flug nach Turin hatte, wie viele Nudelsorten es in Turiner Nobelsupermärkten gibt. In ausufernden Zitaten gibt er wieder, wer vor ihm schon nach Italien reiste, Goethe und Nietzsche, Bachmann und Bernhard, Henscheid und Krausser. Jan Brandt also in bester Gesellschaft.
Obendrein erstellt er eine Übersicht der Schriftsteller, die sich umgebracht haben, inklusive Methode, in Turin und anderswo. Jan Brandt, quasi ein Borderliner?
Eine Satire über den Literaturbetrieb
Neben Beschreibungen der alten Fiat-Zentrale, von Shopping-Centern und nobel designten Hotels mit Palmengärten geht es immer wieder um die Selbstfindung, um das, was den Schriftsteller ausmacht. Brandt setzt sich damit auseinander, was die plötzliche Berühmtheit in seinem Leben veränderte, welche Träume wach werden von einem Haus am Meer, von Buchverfilmungen und permanenten Fernsehauftritten. Allgegenwärtig ist die Gefahr, nach dem Rummel in die Bedeutungslosigkeit abzustürzen. Auch diese Selbstreflexionen, durchaus ironisch eingefärbt, sind nicht neu.
So ist "Tod in Turin" neben einer Satire über den Literaturbetrieb ein Buch darüber, in welche Abgründe der Schriftsteller blickt, wenn er neben dem Schreiben eine andere Rolle einnimmt, wenn er sich als Vermarkter seiner selbst zu perfektionieren sucht.
In der Tat, das zweite Buch ist ziemlich schwer, Jan Brandt beschönigt nichts, er legt die Karten auf den Tisch. Außer einem streckenweise sehr komischen Reisebericht ist ihm nichts eingefallen, zumindest kein Roman, der es mit dem ersten aufnehmen könnte.
Jan Brandt: "Tod in Turin"
DuMont Verlag, Köln 2015
304 Seiten, 19,99 Euro
DuMont Verlag, Köln 2015
304 Seiten, 19,99 Euro