Zwei Jahrzehnte nach dem Erdgipfel
Moderation: Claus Leggewie · 24.06.2012
Im Zusammenhang mit der Konferenz "Rio+20" - der Neuauflage des Erdgipfels von 1992 - tut sich die Frage auf: Wem gehört die Erde, wem ihre Atmosphäre? Und ferner: Könnte ein Umdenken des Besitz-Gedankens einen nachhaltigeren Umweltschutz fördern? Darüber unterhält sich Claus Leggewie mit seinen Gästen in einem "Lesart Spezial".
Claus Leggewie: Guten Tag zu einer neuen Ausgabe von "Lesart Spezial", der politischen Buchsendung von Deutschlandradio Kultur, aus dem Café Central im Schauspiel Essen, gemeinsam mit der Buchhandlung "Proust" und unserem Medienpartner, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Ich bin Claus Leggewie vom Kulturwissenschaftlichen Institut.
Soeben zu Ende gegangen ist der sogenannte Rio+-20-Gipfel und wir fragen: Was hat sich eigentlich seit dem letzten sogenannten Erdgipfel in Rio de Janeiro im Jahr 1992 tatsächlich geändert? Wie gehen wir 20 Jahre danach, das war ein sehr hoffnungsvoller Gipfel damals mit den immer drängender werdenden Themen Klimawandel und Artensterben, um?
Die Konklusion dieses Gipfels lautet wohl: Green Economy, grüne Wirtschaft, Green Growth, grünes Wachstum. Aber ist das nachhaltig, sozial gerecht? Ist es ein echter Beitrag zum Schutz globaler Kollektivgüter? Und ist es ein Beitrag zur Überwindung der Armut in der Welt?
Wir haben zwei Gäste, die das sicherlich beantworten können. Zum einen Professor Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom und stellvertretender Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, berät die Weltbank, ist einer der leitenden Köpfe im IPCC, dem Uno-Weltklimarat – und neuerdings auch Direktor des Research Institute on Global Commons and Climate Change in Potsdam. Dieses Institut behauptet im Titel: die Atmosphäre, in die wir viel zu viel CO2 schon deponiert haben, die ist ein Allmende-Gut, ein Gemeingut, und muss als solches wieder erkannt und gepflegt werden. Herr Edenhofer hat ein neues Buch herausgegeben, ganz aktuell zu diesem Thema, es ist in Englisch: "Climate Change, Justice and Sustainability", also Klimawandel, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Darüber werden wir als erstes in unserer Sendung reden.
Unser zweiter Gast ist Professor Christoph Bieber. Er ist Stiftungsprofessor für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der Universität Duisburg-Essen und er lehrt an der NRW School of Governance und stellt uns heute ein weiteres Buch vor, nämlich von Silke Helfrich. Das hat sie für die Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben mit dem Titel "Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat".
Und hier kommt wieder dieser Zauberbegriff Commons, über den wir heute reden wollen. Keine leichte Kost, zwei Bücher, die als Sachbücher es in sich haben, die nicht so ganz leicht zu lesen sind, aber die politisch von großem Gewicht sind. Darüber wollen wir reden. Schön, dass Sie beide hier sind und auch mit unserem Publikum im Schauspiel Essen diskutieren werden!
Herr Edenhofer, Sie sind nicht in Rio gewesen, ansonsten aber als Mitglied dieses IPCC, des Weltklimarates, sehr viel unterwegs in der Welt, wie ich weiß. Hatten Sie anderes oder besseres zu tun?
Ottmar Edenhofer: Ich würde sagen, ich hatte Besseres zu tun, weil ich im Rahmen des IPCC gerade den nächsten Sachstandsbericht vorbereite und dieser nächste Sachstandsbericht hat ein großes Gewicht, insofern denke ich, es sind so viele hochrangige Repräsentanten in Rio, dass es da auf mich nicht mehr angekommen ist.
Leggewie: Wenn man sich anschaut, wie das vor 20 Jahren begonnen hat – wir sollten vielleicht eine kleine Rückblende machen. Vor 20 Jahren, also die Mauer war weg, die Blöcke lösten sich auf, die Sowjetunion gab es nicht mehr, die Vereinigten Staaten schienen die einzige Supermacht der Welt zu sein. Und dann kommt so ein Thema in Rio, der Erdgipfel, also hier wird Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch das Klima, das ist die Entstehung der Klima-Rahmen-Konvention der Vereinten Nationen gewesen, dieses Thema kommt jetzt. Und viele, die dabei waren, hatten damals die Vorstellung, dass jetzt das Thema, was wir beispielsweise hier in Deutschland als grün, alternativ, ökologisch diskutiert haben, dass das jetzt zum Weltthema wird. Wenn man Bilanz zieht, sehen Sie eher die positiven Entwicklungen oder sind Sie skeptisch?
Edenhofer: Wenn man das aus der Perspektive sieht, wie das damals begonnen hat, würde ich sagen, ist doch eine Menge passiert. Es ist die Klima-Rahmen-Konvention geboren, es hat die Berichte des Weltklimarates gegeben und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt 20 Jahre damit verbracht – mit der Frage: Ist denn der Klimawandel überhaupt vom Menschen gemacht? Und ohne die Klima-Rahmen-Konvention, ohne die Berichte des Weltklimarates hätten wir dazu keinen Weltkonsens. Und ich glaube, es gibt einen solchen Weltkonsens. Natürlich wird der immer wieder bestritten. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, das muss man noch mal neu diskutieren. Das ist genauso, wenn man sagen würde, man muss auch noch mal neu über die Hauptsätze der Thermodynamik nachdenken. Das soll man immer wieder mal machen, aber es ist doch kanonisches Wissen in der Physik. Und es gibt auch in der Klimawissenschaft kanonisches Wissen. Das heißt, wir wissen, der Mensch hat durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und durch die Abholzung die globale Mitteltemperatur erhöht. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt nach vorne gewesen. Wenn man natürlich jetzt das mit der Elle misst, haben wir das Problem gelöst, sind wir dabei, das Problem zu lösen, haben wir gute Strategien entwickelt – nein, würde ich nicht sagen.
Leggewie: In Ihrem Buch spielt ja jetzt auch die Verbindung zwischen Klimawandel, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und vor allen Dingen der Entwicklungsproblematik, also des armen Südens, eine große Rolle. Sagen Sie uns, wie Sie diese Verbindung herstellen. Man könnte ja auch sagen, das Klimaproblem ist ein Problem, was im Norden besonders viel thematisiert wird und dessen Kosten vor allen Dingen der Süden, der arme Süden, tragen muss. Wie kann man das Thema Klimawandel, wie kann man das verbinden mit der Entwicklungsproblematik, die ja auch eine große Rolle in Rio gespielt hat seinerzeit und die jetzt auch wieder jüngst auf dem G20-Gipfel – jedenfalls am Rande – mitbesprochen worden ist?
Edenhofer: Also, vielleicht gestatten Sie mir, dass ich diese Verbindung herstelle, indem ich ein kleines Märchen, eine kleine Parabel erzähle.
Stellen Sie sich vor, Sie wandern mit zehn Leuten durch die Wüste mit einem begrenzten Wasservorrat. Von diesen zehn Leuten leeren zwei diesen Wasservorrat bis zur Hälfte und dann merkt man, das Wasser wird knapp. Und jetzt kommen die zwei auf eine ganz geniale Idee und sagen: Wisst Ihr was, den Rest des Wassers teilen wir jetzt unter uns gleich auf.
Dann gibt es natürlich eine Riesendebatte drüber, ob das gerecht ist, ob das sinnvoll ist. Am Ende stellt sich die Frage: Bringen sich die Leute in der Wüste gegenseitig um, weil sie sich über die Prinzipien der Gerechtigkeit nicht einigen können oder weil das Wasser am Ende leer ist.
Jetzt ist Herr Bieber da und er möge mir gestatten, dass ich diesen Seitenhieb auf die Philosophen loslasse: In der Gruppe befindet sich natürlich kein Philosoph, sondern die sitzen daheim und schreiben wunderbare Essays, warum es keine gute Idee ist, mit zehn Leuten und einem begrenzten Wasservorrat durch die Wüste zu wandern. Und die Ökonomen können aber auch nicht sehr viel helfen, weil die sagen, es tut uns leid, bei solchen Verteilungskonflikten haben wir keine Rezepte.
Es gibt aber in meinem Märchen eine Frau, die auf die geniale Idee kommt und sagt: Lasst uns doch mal rausfinden, wo die nächste Oase ist, wo das Wasser nicht mehr knapp ist. Und dann geht es eben um die Frage: Kann der Wasservorrat so verteilt werden, dass alle zur Oase kommen, also in eine nachhaltige Welt, wenn man so will, wo eben dann Wasser nicht mehr knapp ist. Oder in unserem Beispiel, wo wir dann eben die Weltwirtschaft soweit dekarbonisiert haben, dass wir darauf nicht mehr angewiesen sind.
Was dieses kleine Märchen zeigt, ist zweierlei: Estens: Die acht, die nicht die Hälfte des Wassers schon konsumiert haben, die sind schwach. Das heißt, es ist die Frage, ob die überhaupt die Oase erreichen können, also brauchen Unterstützung durch die anderen beiden. Und trotzdem besteht die Aufgabe, dass das ganze Problem so verstanden wird, dass es kein Nullsummenspiel wird, dass nicht das Wasser des einen der Verlust beim Wasser des anderen ist. Und Nullsummenspiele lassen sich nicht lösen.
Also man muss sozusagen hier etwas ins Spiel bringen, eben die Oase, eine positive Zukunftsperspektive, auf die sich alle einigen können. Und das Gerechtigkeitsprinzip ist eben dann jenes, das alle instand setzt, alle befähigt, eben die Oase zu erreichen.
Leggewie: Dies Commons-Prinzip, über das wir ein bisschen reden wollen, sagt ja im Grunde genommen, es wird etwas mehr, wenn wir teilen.
Edenhofer: Die Commons-Perspektive ist eigentlich eine neue Sicht auf die Welt, auf den Menschen, wo man eben sagt, wir können eigentlich kooperieren, wir können sogar kollektiv handeln, wir können durch Kooperation Dinge erreichen, die wir eben durch Konkurrenz nicht erreichen könnten.
Das 21. Jahrhundert wird davon geprägt sein, dass wir kooperieren, wir werden aber auch neue Eigentumsformen entwickeln müssen. Und diese neue Eigentumsform, das bezieht sich dann eben auf Atmosphäre, Ozeane, Wälder. Und der entscheidende Punkt scheint mir eben zu sein, ein Commons, ein globales Gemeingut, das fällt nicht vom Himmel. Das ist ein politischer Akt, ein rechtsetzender Akt, dazu müssen sich Menschen entschließen, dass sie das als ein globales Gemeingut betrachten wollen.
Leggewie: Kooperationsthema ist ja auch eine interessante Entwicklung. Wenn wir noch mal auf 92 zurückblicken, die Blöcke hatten sich aufgelöst. Das waren zwei Blöcke, die sich antagonistisch gegenüberstanden. Die waren militärisch, ideologisch, politisch, wirtschaftlich auf völlig anderen Ufern, aber die haben ein Kooperationsmuster, nämlich das der friedlichen Koexistenz, am Ende gefunden.
Heute haben wir keine Blöcke mehr. Wir haben mehrere Player auf der Welt. Wir haben eine multipolare Welt, wie man neudeutsch sagt, also wir haben die Chinesen, die Schwellenländer haben Sie schon erwähnt, und es gibt diesen Konsens, den Sie beschrieben haben. Man sagt sogar, über zwei Grad hinaus darf die Temperatur nicht ansteigen.
Aber wir haben keine Instrumente gefunden, wir haben keine Eigentumsformen gefunden, mit denen wir das dann auch machen können. Also, das nenne ich das Kooperationsparadox. Eigentlich sind wir uns ideologisch, weltanschaulich, politisch näher gerückt. Heute gibt es sehr viele Demokratien, heute gibt es überall den Kapitalismus – Ausnahme Nordkorea vielleicht, aber wir haben sozusagen keine Kooperationsmechanismen gefunden.
Ich hab noch eine Frage: Wenn Sie so ein Buch machen, das ist nun Fachwissenschaft, die da vertreten wird, Sie haben es gerade sehr schön rübergebracht, was im Buch – mit diesem Märchen, was da drin steht. Wie ist das mit einem Gremium, auch das IPCC oder das Potsdam-Institut, lassen sich Politikerinnen und Politiker durch Sie beraten?
Edenhofer: Ja! Ich glaube schon, dass sich Politiker beraten lassen. Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass Politiker dümmer oder amoralischer sind als wir. Es ist nur einfach so, dass die Handlungszwänge, unter denen die Leute stehen und arbeiten, einfach gewaltig sind.
Und Langfrist-Themen haben – aus meiner Sicht – zunächst mal in Demokratien schlechte Karten. Die werden nur dann gute Karten bekommen, wenn die Zivilgesellschaft darauf besonders energisch und nachdringlich reagiert. Dann können sich Politiker diesem Druck nicht mehr entziehen. Und deswegen glaube ich, dass ohne Zivilgesellschaft oder ohne zivilgesellschaftlichen Konsens, ohne Bewusstsein, aus meiner Sicht eine Bewegung zu mehr Klimaschutz, zu mehr Nachhaltigkeit, unmöglich ist.
Leggwie: Die Formel, auf die sich jetzt viele in der Welt einigen können, ist: grünes Wachstum – Green Growth. Oder überhaupt generell eine Green Economy, eine ergrünte Wirtschaft.
Edenhofer: Ja, grüne Wirtschaft, das hört sich gut an. Bei Licht betrachtet, muss ich sagen, ist es ein Ärgernis. Wir haben jetzt viele Klimagipfel hinter uns. Und auf diesen Klimagipfeln sollte ja genau das passieren, dass aus einem freien Land, das jeder nach seinem Gutdünken nutzen kann, eine globale Allmende werden sollte – mit Nutzungsrecht natürlich. Die Atmosphäre sollte zu einem globalen Gemeingut werden. Und das haben wir nicht geschafft.
Und jetzt sagen die Leute, also das ist doch eigentlich eine furchtbar frustrierende Geschichte. Jetzt wollen wir nicht noch mal einen Gipfel machen, der noch mal scheitert, jetzt machen wir ganz was anderes. Wir erfinden jetzt ein neues Label und dieses neue Label nennen wir Green Growth, grünes Wachstum.
Diese grüne Wachstumsgeschichte geht folgendermaßen: Die sagt, lasst uns interessante Dinge tun - wie den Zugang zur Energie erhöhen, lasst uns die Energie-Effizienz steigern, lasst uns die Erneuerbaren subventionieren. Also, wir tun alles wunderbare Dinge. Und so ganz nebenbei, fast so wie eine unbeabsichtigte Nebenwirkung, lösen sie auch die Klimaprobleme. Lasst euch doch von diesen Verrückten nix erzählen, die jetzt da sagen, wir haben globale Gemeingüter, wir werden das kooperativ nie einlösen können. Das ist viel zu komplex, das ist Professoren-Elaborat, typisch deutsches Kantsches Produkt, wo Leute, die einfach studiert sind, sitzen und nicht den Mut haben, sich mit dem realen Leben zu konfrontieren, solche Leute kommen auf solche Ideen. Lasst uns Green Growth machen, wir erhöhen die Energie-Effizienz, und dann wird sich das alles wunderbar lösen.
Was ist der Haken an der ganzen Sache? Der Haken an der Sache ist, dass dieses Konzept nicht funktioniert, weil wenn wir die Energie-Effizienz erhöhen, dann werden wir zunächst mal weniger fossile Energieträger brauchen. Aber damit schaffen wir erst den Spielraum, dass wir durch mehr Wachstum diese Effizienzgewinne überkompensieren.
Das sehen wir seit 20 Jahren. Wir steigern die Energie-Effizienz. Wir haben effizientere Autos, wir haben effizientere Kühlschränke und das Wirtschaftswachstum überkompensiert. Das geht sogar soweit, dass in den letzten vier, fünf Jahren die Wachstumsraten der Emissionen stärker gestiegen sind denn je. Also, wenn wir auf die Emissionsdaten gucken, da sehen wir weder Kyoto, da sehen wir weder Rio, da sehen wir gar nix.
Was wir dort sehen, ist die größte Kohle-Renaissance in der Menschheitsgeschichte. Und vor so einem Hintergrund heißt grünes Wachstum nicht mehr und nicht weniger, als einer Sache einen grünen Anstrich geben, die einfach heißt: Wir machen mit unserem Wachstum weiter wie bisher. Anstatt zu sagen: Wir müssen ein Reglement finden, einen ordnungspolitischen Rahmen, dass aus einer Allmende, wo jeder Zugang hat, die übernutzt werden kann, wie die Atmosphäre, ein globales Gemeingut machen. Und daran führt kein Weg vorbei.
Und wenn dieses globale Gemeinschaftsgut juristisch durch Kooperationen, durch Zustimmung aller Nationalstaaten festgelegt wird, dann kann natürlich Energie-Effizienzsteigerung, Förderung von erneuerbaren Energien, Energiezugang für Arme eine wunderbare Wirkung entfalten. Aber ohne diesen Rahmen wird das Ganze in die falsche Richtung laufen.
Leggewie: Herr Bieber, ein Gespenst geht um in Europa, der Commonismus. Ich habe mich nicht versprochen, ich habe nicht Kommunismus gesagt, wie Karl Marx, Weiland, sondern Commonismus. Die Commons, wir haben schon drüber geredet, Commoning, die Commoners, was ist das überhaupt?
Bieber: In dem Fall hilft in der Tat erst mal ein Blick in das gewichtige Werk, das Silke Helfrich vorgelegt hat, das – so unwahrscheinlich es klingen mag – in der Zeit des Commoning tatsächlich als handfestes Buch auf dem Tisch liegt. Wenn man reinschaut, finden sich dort imposante 75 Einzelbeiträge, was das Buch erstaunlicherweise extrem lesbar macht. Die sind in der Regel sehr, sehr kurz gehalten und beschreiben genau dieses Prinzip der Commons aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.
Es beginnt mit einer Art Manifest und das passt eigentlich sehr gut zu dem, was Herr Edenhofer schon gesagt hat, mit der Abgrenzung, was kennzeichnet das 20. und das 21. Jahrhundert. Und das ist in der Tat ein sehr stark nach vorne gerichtetes Manifest, das sagt, wir müssen uns von dem bisherigen Duopol aus Staat und Markt verabschieden. Es kann nicht über Wachstum gehen, es muss Kooperation sein. Aber aufgrund der langen Erfahrung im Zusammenhang mit dem Kapitalismus brauchen wir dafür erst mal eine neue Sprache.
Und so steigt man ein, indem man den Begriff der Commons noch einmal als Kollektivgüter skizziert und sagt, das ist aber nicht alles. Es sind nicht nur die Ressourcen, sondern es sind auch die Menschen, die etwas mit diesen Ressourcen tun, sie als solche erkennen, sie als Gemeingüter bearbeiten und damit etwas anderes verbinden als den reinen Wachstumsgedanken. Das wären die Commoners.
Und aus deren Aktivitäten heraus entstehen bestimmte Praktiken, die dann dazu beitragen, dass sich Dinge ändern können. Und das wird im Buch, zum einen an den Gemeingütern deutlich gemacht, die wir im Umfeld Klima, Umwelt, Energie kennen gelernt haben in den letzten Jahren – oder noch mal stärker kennen gelernt haben, aber eben auch mit anderen Gemeingütern, wie eben dem Wissen zum Beispiel, aber auch – da wird es dann schon kleinteiliger – der Software, wo es ein stärker technisches Gewicht erhält, und wo wir ganz ähnliche Mechanismen am Werk sehen.
Insofern wird hier ein ganz breites Bild gezeichnet, wo nicht nur Gemeingüter in Gefahr sind, wo sie eingehegt werden, noch von den – aus dem 20. Jahrhundert hereinreichenden Kräften, das sind in vielen Fällen eben Firmen oder eben staatliche Akteure. Und es wird aber ein sehr spannendes Bild gezeichnet von Akteuren, die etwas anderes machen.
Leggewie: Dieser Begriff "Allmende" ist ja ein sehr alter Begriff. Wir sollten mal erklären, was eigentlich mal eine Allmende war, woher der Begriff kommt, Allmende-Güter. Wir sollten zweitens einen einflussreichen Artikel, den es mal gegeben hat in der Wirtschaftswissenschaft, ich glaube, '68, Garrett Hardin "Die Tragödie der Allmende". Das ist ja ein wichtiger wirtschaftswissenschaftlicher Beitrag gewesen. Was ist eine Allmende gewesen – historisch? Was ist da die Tragödie an derselben?
Edenhofer: Die Ökonomen arbeiten gerne mit Märchen und das ist der stärkste Teil der Ökonomie. Und so ist auch die Allmende ein Märchen. Man stellt sich also vor, eine Gemeindewiese, und auf dieser Gemeindewiese kann also jeder Bauer seine Kuh weiden lassen. Und was passiert?
Das ist genau das, das Hardin beschreibt, es passiert die Tragödie, nämlich dass die Weide übernutzt wird. Und man hat dann damals gesagt, die Grundidee muss sein, dass also die Allmenden abgeschafft werden und entweder zu Privateigentum erklärt werden oder aber dass der Staat, ein Leviathan gewissermaßen, dann durch Law and Order, durch Command and Control, eben festlegt, wer jetzt welche Kuh auf die Weide stellen darf.
Das ist sozusagen genau die Dichotomie zwischen Staat und Markt, also gewissermaßen der übermächtige Leviathan oder die privaten Eigentumsrechte. Und dann gab es eine Frau, und das ist in meinem Märchen wohl bedacht gewesen, da kommt auch eine Frau, das war nämlich Elinor Ostrom, die sich über diesen Aufsatz furchtbar geärgert hat, weil sie gesagt hat, das stimmt doch überhaupt nicht. Es gibt so viele Allmende-Güter auf der ganzen Welt, die hervorragend bewirtschaftet werden, und zwar als Allmenden und nicht als Privateigentum und auch nicht durch den Staat, sondern die durch eine dritte Art von Arrangement bewirtschaftet werden.
Leggewie: Zum Beispiel?
Edenhofer: Ja, zum Beispiel durch Normen, dass Leute sozusagen – eben die Bauern –sich gegenseitig durchaus beobachten, dass es so was gibt wie soziale Präferenzen, dass man eben eine Gemeindewiese nicht ausbeutet, sondern dass man sich drum kümmert, dass es eben Absprachen gibt, wer wann wie das macht, und dass es als unanständig gilt, einfach eine Gemeindewiese zu übernutzen.
Ich habe das selber mal erlebt. Ich habe mal als junger Mensch eine Sozialstation gegründet. Da ging es also um eine Pflege-Common sozusagen, wer darf Zugriff haben auf Pflegedienstleistungen. Da haben sich zehn Leute zu einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zusammengeschlossen, der wurde nicht ausgebeutet. Am Jahresende wurde da viel gespendet, damit der weitermachen kann, damit jeder das gleiche Recht auf Pflegeleistungen hat.
Und das sind Erlebnisse oder Einsichten in diese Struktur vom Commons, wo eben dann Normen, gegenseitige Absprachen eine Rolle spielen. Wir könnten es jetzt wissenschaftlicher ausdrücken, wo soziale Präferenzen eine Rolle spielen, wo nicht der Homo Oeconomicus, dieser langweilige Krämer, kalkuliert, wo jetzt sein Nutzen ist, sondern wo er eben auch die Perspektiven der anderen miteinbezieht.
Übrigens etwas, was auch der Gründungsvater der Nationalökonomie Adam Smith durchaus im Blick hatte. Adam Smith hat nicht den Krämer im Blick gehabt, sondern vor allem die Menschen, die miteinander sprechen.
Leggewie: Die gegenwärtige Ökonomie läuft ja in eine etwas andere Richtung. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf, dass die Gedanken, die Sie gerade vertreten, weder in der Wirtschaftswissenschaft besonders populär sind, noch vor allen Dingen das Handeln, das wirtschaftliche Handeln der Wirtschaftsakteure bestimmen. Kommt da aus dem, was man so Internet nennt, also dem Netz, kommen da andere Impulse? Gibt es da sozusagen ein Beispiel, die Übertragung dieser Allmende-Dimension auf das, was wir Internet nennen?
Bieber: Ja, also man hat eine sehr, sehr gute Anschlussstelle zum Problem der Übernutzung bei der analogen Allmende, bei der digitalen hat man eher das Problem der Unternutzung. Darum kreist im Moment ja auch gerade die Debatte um das Urheberrecht, was ja in gewisser Weise auch eine Norm wäre, wo es um soziale Präferenzen geht – eben eher von den 20. Jahrhundert-Akteuren, die versuchen, dieses Gemeingut einzuhegen.
Das ist jetzt eigentlich das Spannende, dass man sich mit widerstrebenden Ordnungsprozessen auseinandersetzen muss. Die eine Allmende ist übergenutzt, die digitale scheint untergenutzt zu sein, einfach weil das Verteilungsproblem, das Sie uns geschildert haben mit dem Wasser, im digitalen Fall so an der Stelle nicht funktioniert, weil da kann man eben tatsächlich teilen, ohne dass man anderen etwas wegnimmt, wenn man Dinge kopiert.
Und diese Grundproblematik wird gerade jetzt in dieser Commoning-Szene massiv diskutiert und führt tatsächlich auch zu neuen Verfahren und Techniken, wie man versucht, mit diesen veränderten Situationen umzugehen. Gerade das Beispiel wären die Creative Commons, was eben der Versuch ist oder das Copyleft in einem Gegensatz zum Copyright, wo man ganz explizit Bezug nimmt auf bestehende Regelsysteme, die sich an der analogen Allmende orientieren, und diese versucht umzukehren oder an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
Und da ist man, vielleicht so ähnlich wie Rio minus 20, gerade jetzt erst an der Stelle, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie man diesen neu entstehenden Verteilungsraum tatsächlich anders strukturieren und nutzen kann. Und dieser Prozess hat gerade erst begonnen.
Leggewie: Machen Sie es doch bitte noch mal deutlich an dem Creative Commons. Das kennen ja nicht alle. Was ist daran das neue Prinzip?
Bieber: Ich kann nun als Autor eines Werkes selbst darüber verfügen, welche Urheberrechte ich gewissermaßen für mich behalten will, eigentlich alle, oder ich veräußere sie, ich überschreibe sie gewissermaßen in das Gemeingut, in die digitale Allmende, indem ich das Werk vollständig freigebe oder indem ich es in Teilen freigebe.
Man muss dann ins Kleingedruckte schauen, da steht dann öfter mal some rights reserved, also einige Rechte bleiben beim Autor. Aber es steht dem Autor frei, dass er sich eben nicht so strikt - wie nach dem klassischen Urheberrecht - komplett einer bestehenden Norm unterordnet, sondern er verfügt darüber. Er hat eine Möglichkeit, hier selbst zu bestimmen, welche Teile des Werkes frei bleiben, welche gewissermaßen in seiner eigenen Domäne bleiben, oder ob eben das Werk, das geschaffen wird, tatsächlich für alle gleichermaßen frei zu nutzen ist.
Edenhofer: Ich möchte noch mal gern zu dieser Wissens-Allmende. Sie haben völlig Recht, wir sollten nicht nur darüber reden, dass Allmenden übernutzt und auch unternutzt werden. Das hat eine sehr dramatische Wirkung, zum Beispiel bei Medikamenten. Wenn man heute ein Medikament herstellen wollte gegen Malaria, dann müsste man sehr viele Patente aufkaufen. Das Produkt herzustellen, kostet fast nichts, aber der Aufkauf der Patente, der kostet eine ganze Menge. Und es ist meistens unmöglich, die alle aufzukaufen.
Das heißt also: Privateigentum an Wissen kann dazu führen, dass wir die Wissens-Allmenden unternutzen, Dinge ungetan lassen, die wir eigentlich ohne Schwierigkeiten machen könnten, wenn das sozusagen wie eine Allmende organisiert wäre.
Das Gleiche gilt mit der Frage, ob also zum Beispiel die genetische Ausstattung der Welt patentiert werden kann. Was soll denn überhaupt Privateigentum sein? Und was darf denn überhaupt der privaten Nutzung zugeführt werden?
So gibt es also eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, wir müssten eigentlich diese Patente poolen und müssten sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und das zeigt eigentlich nur, dieses Unternutzungs- und Übernutzungsthema, dass der Begriff der Commons, der Gemeinschaftsgüter, eine unglaubliche Kraft hat, um zentrale Prozesse der Globalisierung zu analysieren.
Deutschlandradio Kultur: Herr Bieber, ist das eine neue politische Bewegung womöglich, der Commonismus?
Bieber: Na ja, zurzeit sicherlich noch eine sehr, sehr zerstreute, die sich an der einen oder anderen Stelle aber dann durchaus auch schon mal materialisieren kann.
Und Sie spielen vermutlich auf diese Piraten an, und das könnte in der Tat eine solche Strömung sein, bei der man – zumindest hier in Deutschland – Ansätze schon einer solchen Partei der Commons erkennen kann. Wenn es eben um Fragen der Netzpolitik geht, wo eben genau diese Verteilungsfragen eine große Rolle spielen, aber am Beispiel der Piraten sieht man, dass dieses Prinzip eigentlich das Entscheidende ist, und nicht ein bestimmtes Thema, wie jetzt das Urheberrecht, sondern das Prinzip ist das Relevante.
Wenn es den Piraten gelingt, deutlich zu machen, dass das Verteilungsprinzip auch in anderen Politikfeldern funktioniert, dann könnte das tatsächlich auch eine nachhaltige Entwicklung sein. Als Beispiel wäre das bedingungslose Grundeinkommen zu nennen, was eben auch in diese Richtung weist. Oder die Forderung nach einem fahrscheinlosen – nicht kostenlosen – fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr, was eben den Transport in Richtung dieser Allmende-Qualität rückt. Das könnte tatsächlich zu einer Bewegung werden, aber da ein festes Urteil abzugeben, ist natürlich auch noch zu früh.
Leggewie: Die andere Seite, Ihre Kolleginnen und Kollegen an den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühlen, nehmen die diese Gedanken jetzt zunehmend auf und vor allen Dingen wirtschaftliche Akteure, finden die das, was wir hier erzählen, Spinnerei oder nicht Commonismus, sondern Kommunismus? Hat das eine realistische Chance, dass sich ein solches Kooperationsprinzip, wie Sie es schildern, durchsetzt?
Edenhofer: Zunächst mal hat ja Elinor Ostrom den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Und das ist sicherlich ein Denken, das die große paradigmatische Kraft hat. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass sich solche Gedanken einer überwältigen Zustimmung erfreuen an den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühlen.
Es geht aber weniger um die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühle, sondern es geht darum, Sie haben das ja durch Ihre Konnotation zum Ausdruck gebracht – der Commonismus scheint auf den ersten Blick ein Angriff auf den Liberalismus zu sein. Und das ist eben dann die Frage, die wirklich wichtige Frage, die zu klären ist. Über welche Freiheit reden wir? Ist es die gleiche Freiheit aller? Und das muss geklärt werden.
Und ich denke, die Perspektive der Allmende hat aus meiner Sicht in keinerlei Weise irgendetwas damit zu tun, dass dort Akteure unterdrückt werden, dass Kreativität unterbunden wird. Was diese Form der Commons machen will, ist, Kreativität zu entfesseln.
Und im Übrigen ist es nicht so ganz – die Gedanken um die Commons sind ja nicht neu. Das haben Sie ja schon angeschnitten, die sind ja nicht durch Hardin erst erfunden worden. Das ist eigentlich – geht sogar zurück bis zu Thomas von Aquin, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf, das ist immerhin ein Kirchenvater der katholischen Kirche und revolutionärer Umtriebe unverdächtig. Der hat schon etwas gesagt, nämlich von der universalen Widmung der Erdengüter. Der war der Auffassung, dass zunächst mal die Welt, die Schöpfung, Gemeineigentum der Menschheit ist und dass sich das Privateigentum erst als die überlegene Ordnungsform erweisen muss. Und erst wenn klar ist, dass das besser ist als Gemeineigentum – Commons – und besser ist als staatliches Eigentum, dann machen wir Privateigentum und vice versa.
Leggewie: Gut, jetzt haben wir auch noch den Segen für dieses Prinzip. Karl Valentin hat gesagt: der Mensch ist gut, nur die Leut' sind schlecht. Herr Edenhofer, das wollen Sie uns noch erklären.
Edenhofer: Ja, also zunächst mal, das ist eine Kritik an den Intellektuellen, die gerne über den Menschen sprechen, aber dann schnell die Nase voll haben von den konkreten Leuten. Aber es ist auch so mit der Kooperation, der Mensch ist gut, der Mensch ist zur Kooperation befähigt. Er ist auch auf Kooperationen – ich würde sogar sagen – geschaffen. Aber natürlich, in allen in uns, es braucht auch die richtigen Anreize.
Also, man muss sozusagen diese hehre Prinzip, der Mensch will kooperieren, er ist die kooperative Spezies, das muss auch eingelöst werden durch sehr konkrete Anreize. Und da muss man auch damit rechnen, dass die konkreten Leute manchmal schlecht sind. Und damit muss auch jemand fertig werden, der für Kooperation eintritt.
Und Karl Valentin ist da ein guter Ratgeber, weil Karl Valentin ein gutes Gespür für dieses Skurrile und Abgründige hat. Und ohne dieses Gespür für das Skurrile und Abgründige kann man nicht sinnvoll streiten für globale Gemeingüter.
Leggewie: Und das war nämlich Ihr Buchtipp auch am Schluss dieser Sendung. Martin Maier: "Der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Mit Karl Valentin Sinn und Wahnsinn des Lebens entschlüsseln", im Herder Verlag erschienen.
Herr Bieber, ganz kurz noch, Sie haben auch noch einen Buchtipp.
Bieber: Ja, der schließt an das digitale Ende des Themas an. Es ist ein Buch von Douglas Coupland, einem kanadischen Romancier müsste man eigentlich sagen, der aber eine Biografie von Marshall McLuhan geschrieben hat, die sich ein bisschen unterscheidet von den Biografien, die man so kennt. Er hat Versatzstücke aus dem Netz eingesammelt, die in Bezug zu dieser Biografie gesetzt. Das ist, glaube ich, ganz spannend, einen Denker jetzt noch mal wieder zu lesen in einer neuen Perspektive, weil vielleicht gerade jetzt erst wir medial in die Richtung kommen, die er mit seinen Ideen vorausgeahnt hat. Und das von einem Autor, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit jungen Menschen der 90er- und 2000er-Jahre, mit einer bestimmten Kultur, die im Umfeld des Internet entstanden ist, auseinandergesetzt hat. Und dieser Crash of Cultures, der ist eigentlich sehr, sehr spannend.
Leggewie: Es geht voran. Wir haben die Bücher alle auf der Webseite von Deutschlandradio Kultur und beim Kulturwissenschaftlichen Institut und bei der Buchhandlung "Proust".
Das war "Lesart Spezial" in Deutschlandradio Kultur, aus dem Café Central im Schauspiel Essen, mit der Buchhandlung "Proust" und dem Medienpartner WAZ.
Besprochen haben wir sehr interessante Bücher – kaufen Sie diese Bücher! Es verabschiedet sich Claus Leggewie und wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag!
Weiterführende Links zum Thema:
Themenportal Rio+20
Die UN-Konferenz Rio+20
Soeben zu Ende gegangen ist der sogenannte Rio+-20-Gipfel und wir fragen: Was hat sich eigentlich seit dem letzten sogenannten Erdgipfel in Rio de Janeiro im Jahr 1992 tatsächlich geändert? Wie gehen wir 20 Jahre danach, das war ein sehr hoffnungsvoller Gipfel damals mit den immer drängender werdenden Themen Klimawandel und Artensterben, um?
Die Konklusion dieses Gipfels lautet wohl: Green Economy, grüne Wirtschaft, Green Growth, grünes Wachstum. Aber ist das nachhaltig, sozial gerecht? Ist es ein echter Beitrag zum Schutz globaler Kollektivgüter? Und ist es ein Beitrag zur Überwindung der Armut in der Welt?
Wir haben zwei Gäste, die das sicherlich beantworten können. Zum einen Professor Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom und stellvertretender Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, berät die Weltbank, ist einer der leitenden Köpfe im IPCC, dem Uno-Weltklimarat – und neuerdings auch Direktor des Research Institute on Global Commons and Climate Change in Potsdam. Dieses Institut behauptet im Titel: die Atmosphäre, in die wir viel zu viel CO2 schon deponiert haben, die ist ein Allmende-Gut, ein Gemeingut, und muss als solches wieder erkannt und gepflegt werden. Herr Edenhofer hat ein neues Buch herausgegeben, ganz aktuell zu diesem Thema, es ist in Englisch: "Climate Change, Justice and Sustainability", also Klimawandel, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Darüber werden wir als erstes in unserer Sendung reden.
Unser zweiter Gast ist Professor Christoph Bieber. Er ist Stiftungsprofessor für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der Universität Duisburg-Essen und er lehrt an der NRW School of Governance und stellt uns heute ein weiteres Buch vor, nämlich von Silke Helfrich. Das hat sie für die Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben mit dem Titel "Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat".
Und hier kommt wieder dieser Zauberbegriff Commons, über den wir heute reden wollen. Keine leichte Kost, zwei Bücher, die als Sachbücher es in sich haben, die nicht so ganz leicht zu lesen sind, aber die politisch von großem Gewicht sind. Darüber wollen wir reden. Schön, dass Sie beide hier sind und auch mit unserem Publikum im Schauspiel Essen diskutieren werden!
Herr Edenhofer, Sie sind nicht in Rio gewesen, ansonsten aber als Mitglied dieses IPCC, des Weltklimarates, sehr viel unterwegs in der Welt, wie ich weiß. Hatten Sie anderes oder besseres zu tun?
Ottmar Edenhofer: Ich würde sagen, ich hatte Besseres zu tun, weil ich im Rahmen des IPCC gerade den nächsten Sachstandsbericht vorbereite und dieser nächste Sachstandsbericht hat ein großes Gewicht, insofern denke ich, es sind so viele hochrangige Repräsentanten in Rio, dass es da auf mich nicht mehr angekommen ist.
Leggewie: Wenn man sich anschaut, wie das vor 20 Jahren begonnen hat – wir sollten vielleicht eine kleine Rückblende machen. Vor 20 Jahren, also die Mauer war weg, die Blöcke lösten sich auf, die Sowjetunion gab es nicht mehr, die Vereinigten Staaten schienen die einzige Supermacht der Welt zu sein. Und dann kommt so ein Thema in Rio, der Erdgipfel, also hier wird Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch das Klima, das ist die Entstehung der Klima-Rahmen-Konvention der Vereinten Nationen gewesen, dieses Thema kommt jetzt. Und viele, die dabei waren, hatten damals die Vorstellung, dass jetzt das Thema, was wir beispielsweise hier in Deutschland als grün, alternativ, ökologisch diskutiert haben, dass das jetzt zum Weltthema wird. Wenn man Bilanz zieht, sehen Sie eher die positiven Entwicklungen oder sind Sie skeptisch?
Edenhofer: Wenn man das aus der Perspektive sieht, wie das damals begonnen hat, würde ich sagen, ist doch eine Menge passiert. Es ist die Klima-Rahmen-Konvention geboren, es hat die Berichte des Weltklimarates gegeben und wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt 20 Jahre damit verbracht – mit der Frage: Ist denn der Klimawandel überhaupt vom Menschen gemacht? Und ohne die Klima-Rahmen-Konvention, ohne die Berichte des Weltklimarates hätten wir dazu keinen Weltkonsens. Und ich glaube, es gibt einen solchen Weltkonsens. Natürlich wird der immer wieder bestritten. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, das muss man noch mal neu diskutieren. Das ist genauso, wenn man sagen würde, man muss auch noch mal neu über die Hauptsätze der Thermodynamik nachdenken. Das soll man immer wieder mal machen, aber es ist doch kanonisches Wissen in der Physik. Und es gibt auch in der Klimawissenschaft kanonisches Wissen. Das heißt, wir wissen, der Mensch hat durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und durch die Abholzung die globale Mitteltemperatur erhöht. Das ist ein ganz gewaltiger Schritt nach vorne gewesen. Wenn man natürlich jetzt das mit der Elle misst, haben wir das Problem gelöst, sind wir dabei, das Problem zu lösen, haben wir gute Strategien entwickelt – nein, würde ich nicht sagen.
Leggewie: In Ihrem Buch spielt ja jetzt auch die Verbindung zwischen Klimawandel, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und vor allen Dingen der Entwicklungsproblematik, also des armen Südens, eine große Rolle. Sagen Sie uns, wie Sie diese Verbindung herstellen. Man könnte ja auch sagen, das Klimaproblem ist ein Problem, was im Norden besonders viel thematisiert wird und dessen Kosten vor allen Dingen der Süden, der arme Süden, tragen muss. Wie kann man das Thema Klimawandel, wie kann man das verbinden mit der Entwicklungsproblematik, die ja auch eine große Rolle in Rio gespielt hat seinerzeit und die jetzt auch wieder jüngst auf dem G20-Gipfel – jedenfalls am Rande – mitbesprochen worden ist?
Edenhofer: Also, vielleicht gestatten Sie mir, dass ich diese Verbindung herstelle, indem ich ein kleines Märchen, eine kleine Parabel erzähle.
Stellen Sie sich vor, Sie wandern mit zehn Leuten durch die Wüste mit einem begrenzten Wasservorrat. Von diesen zehn Leuten leeren zwei diesen Wasservorrat bis zur Hälfte und dann merkt man, das Wasser wird knapp. Und jetzt kommen die zwei auf eine ganz geniale Idee und sagen: Wisst Ihr was, den Rest des Wassers teilen wir jetzt unter uns gleich auf.
Dann gibt es natürlich eine Riesendebatte drüber, ob das gerecht ist, ob das sinnvoll ist. Am Ende stellt sich die Frage: Bringen sich die Leute in der Wüste gegenseitig um, weil sie sich über die Prinzipien der Gerechtigkeit nicht einigen können oder weil das Wasser am Ende leer ist.
Jetzt ist Herr Bieber da und er möge mir gestatten, dass ich diesen Seitenhieb auf die Philosophen loslasse: In der Gruppe befindet sich natürlich kein Philosoph, sondern die sitzen daheim und schreiben wunderbare Essays, warum es keine gute Idee ist, mit zehn Leuten und einem begrenzten Wasservorrat durch die Wüste zu wandern. Und die Ökonomen können aber auch nicht sehr viel helfen, weil die sagen, es tut uns leid, bei solchen Verteilungskonflikten haben wir keine Rezepte.
Es gibt aber in meinem Märchen eine Frau, die auf die geniale Idee kommt und sagt: Lasst uns doch mal rausfinden, wo die nächste Oase ist, wo das Wasser nicht mehr knapp ist. Und dann geht es eben um die Frage: Kann der Wasservorrat so verteilt werden, dass alle zur Oase kommen, also in eine nachhaltige Welt, wenn man so will, wo eben dann Wasser nicht mehr knapp ist. Oder in unserem Beispiel, wo wir dann eben die Weltwirtschaft soweit dekarbonisiert haben, dass wir darauf nicht mehr angewiesen sind.
Was dieses kleine Märchen zeigt, ist zweierlei: Estens: Die acht, die nicht die Hälfte des Wassers schon konsumiert haben, die sind schwach. Das heißt, es ist die Frage, ob die überhaupt die Oase erreichen können, also brauchen Unterstützung durch die anderen beiden. Und trotzdem besteht die Aufgabe, dass das ganze Problem so verstanden wird, dass es kein Nullsummenspiel wird, dass nicht das Wasser des einen der Verlust beim Wasser des anderen ist. Und Nullsummenspiele lassen sich nicht lösen.
Also man muss sozusagen hier etwas ins Spiel bringen, eben die Oase, eine positive Zukunftsperspektive, auf die sich alle einigen können. Und das Gerechtigkeitsprinzip ist eben dann jenes, das alle instand setzt, alle befähigt, eben die Oase zu erreichen.
Leggewie: Dies Commons-Prinzip, über das wir ein bisschen reden wollen, sagt ja im Grunde genommen, es wird etwas mehr, wenn wir teilen.
Edenhofer: Die Commons-Perspektive ist eigentlich eine neue Sicht auf die Welt, auf den Menschen, wo man eben sagt, wir können eigentlich kooperieren, wir können sogar kollektiv handeln, wir können durch Kooperation Dinge erreichen, die wir eben durch Konkurrenz nicht erreichen könnten.
Das 21. Jahrhundert wird davon geprägt sein, dass wir kooperieren, wir werden aber auch neue Eigentumsformen entwickeln müssen. Und diese neue Eigentumsform, das bezieht sich dann eben auf Atmosphäre, Ozeane, Wälder. Und der entscheidende Punkt scheint mir eben zu sein, ein Commons, ein globales Gemeingut, das fällt nicht vom Himmel. Das ist ein politischer Akt, ein rechtsetzender Akt, dazu müssen sich Menschen entschließen, dass sie das als ein globales Gemeingut betrachten wollen.
Leggewie: Kooperationsthema ist ja auch eine interessante Entwicklung. Wenn wir noch mal auf 92 zurückblicken, die Blöcke hatten sich aufgelöst. Das waren zwei Blöcke, die sich antagonistisch gegenüberstanden. Die waren militärisch, ideologisch, politisch, wirtschaftlich auf völlig anderen Ufern, aber die haben ein Kooperationsmuster, nämlich das der friedlichen Koexistenz, am Ende gefunden.
Heute haben wir keine Blöcke mehr. Wir haben mehrere Player auf der Welt. Wir haben eine multipolare Welt, wie man neudeutsch sagt, also wir haben die Chinesen, die Schwellenländer haben Sie schon erwähnt, und es gibt diesen Konsens, den Sie beschrieben haben. Man sagt sogar, über zwei Grad hinaus darf die Temperatur nicht ansteigen.
Aber wir haben keine Instrumente gefunden, wir haben keine Eigentumsformen gefunden, mit denen wir das dann auch machen können. Also, das nenne ich das Kooperationsparadox. Eigentlich sind wir uns ideologisch, weltanschaulich, politisch näher gerückt. Heute gibt es sehr viele Demokratien, heute gibt es überall den Kapitalismus – Ausnahme Nordkorea vielleicht, aber wir haben sozusagen keine Kooperationsmechanismen gefunden.
Ich hab noch eine Frage: Wenn Sie so ein Buch machen, das ist nun Fachwissenschaft, die da vertreten wird, Sie haben es gerade sehr schön rübergebracht, was im Buch – mit diesem Märchen, was da drin steht. Wie ist das mit einem Gremium, auch das IPCC oder das Potsdam-Institut, lassen sich Politikerinnen und Politiker durch Sie beraten?
Edenhofer: Ja! Ich glaube schon, dass sich Politiker beraten lassen. Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass Politiker dümmer oder amoralischer sind als wir. Es ist nur einfach so, dass die Handlungszwänge, unter denen die Leute stehen und arbeiten, einfach gewaltig sind.
Und Langfrist-Themen haben – aus meiner Sicht – zunächst mal in Demokratien schlechte Karten. Die werden nur dann gute Karten bekommen, wenn die Zivilgesellschaft darauf besonders energisch und nachdringlich reagiert. Dann können sich Politiker diesem Druck nicht mehr entziehen. Und deswegen glaube ich, dass ohne Zivilgesellschaft oder ohne zivilgesellschaftlichen Konsens, ohne Bewusstsein, aus meiner Sicht eine Bewegung zu mehr Klimaschutz, zu mehr Nachhaltigkeit, unmöglich ist.
Leggwie: Die Formel, auf die sich jetzt viele in der Welt einigen können, ist: grünes Wachstum – Green Growth. Oder überhaupt generell eine Green Economy, eine ergrünte Wirtschaft.
Edenhofer: Ja, grüne Wirtschaft, das hört sich gut an. Bei Licht betrachtet, muss ich sagen, ist es ein Ärgernis. Wir haben jetzt viele Klimagipfel hinter uns. Und auf diesen Klimagipfeln sollte ja genau das passieren, dass aus einem freien Land, das jeder nach seinem Gutdünken nutzen kann, eine globale Allmende werden sollte – mit Nutzungsrecht natürlich. Die Atmosphäre sollte zu einem globalen Gemeingut werden. Und das haben wir nicht geschafft.
Und jetzt sagen die Leute, also das ist doch eigentlich eine furchtbar frustrierende Geschichte. Jetzt wollen wir nicht noch mal einen Gipfel machen, der noch mal scheitert, jetzt machen wir ganz was anderes. Wir erfinden jetzt ein neues Label und dieses neue Label nennen wir Green Growth, grünes Wachstum.
Diese grüne Wachstumsgeschichte geht folgendermaßen: Die sagt, lasst uns interessante Dinge tun - wie den Zugang zur Energie erhöhen, lasst uns die Energie-Effizienz steigern, lasst uns die Erneuerbaren subventionieren. Also, wir tun alles wunderbare Dinge. Und so ganz nebenbei, fast so wie eine unbeabsichtigte Nebenwirkung, lösen sie auch die Klimaprobleme. Lasst euch doch von diesen Verrückten nix erzählen, die jetzt da sagen, wir haben globale Gemeingüter, wir werden das kooperativ nie einlösen können. Das ist viel zu komplex, das ist Professoren-Elaborat, typisch deutsches Kantsches Produkt, wo Leute, die einfach studiert sind, sitzen und nicht den Mut haben, sich mit dem realen Leben zu konfrontieren, solche Leute kommen auf solche Ideen. Lasst uns Green Growth machen, wir erhöhen die Energie-Effizienz, und dann wird sich das alles wunderbar lösen.
Was ist der Haken an der ganzen Sache? Der Haken an der Sache ist, dass dieses Konzept nicht funktioniert, weil wenn wir die Energie-Effizienz erhöhen, dann werden wir zunächst mal weniger fossile Energieträger brauchen. Aber damit schaffen wir erst den Spielraum, dass wir durch mehr Wachstum diese Effizienzgewinne überkompensieren.
Das sehen wir seit 20 Jahren. Wir steigern die Energie-Effizienz. Wir haben effizientere Autos, wir haben effizientere Kühlschränke und das Wirtschaftswachstum überkompensiert. Das geht sogar soweit, dass in den letzten vier, fünf Jahren die Wachstumsraten der Emissionen stärker gestiegen sind denn je. Also, wenn wir auf die Emissionsdaten gucken, da sehen wir weder Kyoto, da sehen wir weder Rio, da sehen wir gar nix.
Was wir dort sehen, ist die größte Kohle-Renaissance in der Menschheitsgeschichte. Und vor so einem Hintergrund heißt grünes Wachstum nicht mehr und nicht weniger, als einer Sache einen grünen Anstrich geben, die einfach heißt: Wir machen mit unserem Wachstum weiter wie bisher. Anstatt zu sagen: Wir müssen ein Reglement finden, einen ordnungspolitischen Rahmen, dass aus einer Allmende, wo jeder Zugang hat, die übernutzt werden kann, wie die Atmosphäre, ein globales Gemeingut machen. Und daran führt kein Weg vorbei.
Und wenn dieses globale Gemeinschaftsgut juristisch durch Kooperationen, durch Zustimmung aller Nationalstaaten festgelegt wird, dann kann natürlich Energie-Effizienzsteigerung, Förderung von erneuerbaren Energien, Energiezugang für Arme eine wunderbare Wirkung entfalten. Aber ohne diesen Rahmen wird das Ganze in die falsche Richtung laufen.
Leggewie: Herr Bieber, ein Gespenst geht um in Europa, der Commonismus. Ich habe mich nicht versprochen, ich habe nicht Kommunismus gesagt, wie Karl Marx, Weiland, sondern Commonismus. Die Commons, wir haben schon drüber geredet, Commoning, die Commoners, was ist das überhaupt?
Bieber: In dem Fall hilft in der Tat erst mal ein Blick in das gewichtige Werk, das Silke Helfrich vorgelegt hat, das – so unwahrscheinlich es klingen mag – in der Zeit des Commoning tatsächlich als handfestes Buch auf dem Tisch liegt. Wenn man reinschaut, finden sich dort imposante 75 Einzelbeiträge, was das Buch erstaunlicherweise extrem lesbar macht. Die sind in der Regel sehr, sehr kurz gehalten und beschreiben genau dieses Prinzip der Commons aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.
Es beginnt mit einer Art Manifest und das passt eigentlich sehr gut zu dem, was Herr Edenhofer schon gesagt hat, mit der Abgrenzung, was kennzeichnet das 20. und das 21. Jahrhundert. Und das ist in der Tat ein sehr stark nach vorne gerichtetes Manifest, das sagt, wir müssen uns von dem bisherigen Duopol aus Staat und Markt verabschieden. Es kann nicht über Wachstum gehen, es muss Kooperation sein. Aber aufgrund der langen Erfahrung im Zusammenhang mit dem Kapitalismus brauchen wir dafür erst mal eine neue Sprache.
Und so steigt man ein, indem man den Begriff der Commons noch einmal als Kollektivgüter skizziert und sagt, das ist aber nicht alles. Es sind nicht nur die Ressourcen, sondern es sind auch die Menschen, die etwas mit diesen Ressourcen tun, sie als solche erkennen, sie als Gemeingüter bearbeiten und damit etwas anderes verbinden als den reinen Wachstumsgedanken. Das wären die Commoners.
Und aus deren Aktivitäten heraus entstehen bestimmte Praktiken, die dann dazu beitragen, dass sich Dinge ändern können. Und das wird im Buch, zum einen an den Gemeingütern deutlich gemacht, die wir im Umfeld Klima, Umwelt, Energie kennen gelernt haben in den letzten Jahren – oder noch mal stärker kennen gelernt haben, aber eben auch mit anderen Gemeingütern, wie eben dem Wissen zum Beispiel, aber auch – da wird es dann schon kleinteiliger – der Software, wo es ein stärker technisches Gewicht erhält, und wo wir ganz ähnliche Mechanismen am Werk sehen.
Insofern wird hier ein ganz breites Bild gezeichnet, wo nicht nur Gemeingüter in Gefahr sind, wo sie eingehegt werden, noch von den – aus dem 20. Jahrhundert hereinreichenden Kräften, das sind in vielen Fällen eben Firmen oder eben staatliche Akteure. Und es wird aber ein sehr spannendes Bild gezeichnet von Akteuren, die etwas anderes machen.
Leggewie: Dieser Begriff "Allmende" ist ja ein sehr alter Begriff. Wir sollten mal erklären, was eigentlich mal eine Allmende war, woher der Begriff kommt, Allmende-Güter. Wir sollten zweitens einen einflussreichen Artikel, den es mal gegeben hat in der Wirtschaftswissenschaft, ich glaube, '68, Garrett Hardin "Die Tragödie der Allmende". Das ist ja ein wichtiger wirtschaftswissenschaftlicher Beitrag gewesen. Was ist eine Allmende gewesen – historisch? Was ist da die Tragödie an derselben?
Edenhofer: Die Ökonomen arbeiten gerne mit Märchen und das ist der stärkste Teil der Ökonomie. Und so ist auch die Allmende ein Märchen. Man stellt sich also vor, eine Gemeindewiese, und auf dieser Gemeindewiese kann also jeder Bauer seine Kuh weiden lassen. Und was passiert?
Das ist genau das, das Hardin beschreibt, es passiert die Tragödie, nämlich dass die Weide übernutzt wird. Und man hat dann damals gesagt, die Grundidee muss sein, dass also die Allmenden abgeschafft werden und entweder zu Privateigentum erklärt werden oder aber dass der Staat, ein Leviathan gewissermaßen, dann durch Law and Order, durch Command and Control, eben festlegt, wer jetzt welche Kuh auf die Weide stellen darf.
Das ist sozusagen genau die Dichotomie zwischen Staat und Markt, also gewissermaßen der übermächtige Leviathan oder die privaten Eigentumsrechte. Und dann gab es eine Frau, und das ist in meinem Märchen wohl bedacht gewesen, da kommt auch eine Frau, das war nämlich Elinor Ostrom, die sich über diesen Aufsatz furchtbar geärgert hat, weil sie gesagt hat, das stimmt doch überhaupt nicht. Es gibt so viele Allmende-Güter auf der ganzen Welt, die hervorragend bewirtschaftet werden, und zwar als Allmenden und nicht als Privateigentum und auch nicht durch den Staat, sondern die durch eine dritte Art von Arrangement bewirtschaftet werden.
Leggewie: Zum Beispiel?
Edenhofer: Ja, zum Beispiel durch Normen, dass Leute sozusagen – eben die Bauern –sich gegenseitig durchaus beobachten, dass es so was gibt wie soziale Präferenzen, dass man eben eine Gemeindewiese nicht ausbeutet, sondern dass man sich drum kümmert, dass es eben Absprachen gibt, wer wann wie das macht, und dass es als unanständig gilt, einfach eine Gemeindewiese zu übernutzen.
Ich habe das selber mal erlebt. Ich habe mal als junger Mensch eine Sozialstation gegründet. Da ging es also um eine Pflege-Common sozusagen, wer darf Zugriff haben auf Pflegedienstleistungen. Da haben sich zehn Leute zu einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zusammengeschlossen, der wurde nicht ausgebeutet. Am Jahresende wurde da viel gespendet, damit der weitermachen kann, damit jeder das gleiche Recht auf Pflegeleistungen hat.
Und das sind Erlebnisse oder Einsichten in diese Struktur vom Commons, wo eben dann Normen, gegenseitige Absprachen eine Rolle spielen. Wir könnten es jetzt wissenschaftlicher ausdrücken, wo soziale Präferenzen eine Rolle spielen, wo nicht der Homo Oeconomicus, dieser langweilige Krämer, kalkuliert, wo jetzt sein Nutzen ist, sondern wo er eben auch die Perspektiven der anderen miteinbezieht.
Übrigens etwas, was auch der Gründungsvater der Nationalökonomie Adam Smith durchaus im Blick hatte. Adam Smith hat nicht den Krämer im Blick gehabt, sondern vor allem die Menschen, die miteinander sprechen.
Leggewie: Die gegenwärtige Ökonomie läuft ja in eine etwas andere Richtung. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf, dass die Gedanken, die Sie gerade vertreten, weder in der Wirtschaftswissenschaft besonders populär sind, noch vor allen Dingen das Handeln, das wirtschaftliche Handeln der Wirtschaftsakteure bestimmen. Kommt da aus dem, was man so Internet nennt, also dem Netz, kommen da andere Impulse? Gibt es da sozusagen ein Beispiel, die Übertragung dieser Allmende-Dimension auf das, was wir Internet nennen?
Bieber: Ja, also man hat eine sehr, sehr gute Anschlussstelle zum Problem der Übernutzung bei der analogen Allmende, bei der digitalen hat man eher das Problem der Unternutzung. Darum kreist im Moment ja auch gerade die Debatte um das Urheberrecht, was ja in gewisser Weise auch eine Norm wäre, wo es um soziale Präferenzen geht – eben eher von den 20. Jahrhundert-Akteuren, die versuchen, dieses Gemeingut einzuhegen.
Das ist jetzt eigentlich das Spannende, dass man sich mit widerstrebenden Ordnungsprozessen auseinandersetzen muss. Die eine Allmende ist übergenutzt, die digitale scheint untergenutzt zu sein, einfach weil das Verteilungsproblem, das Sie uns geschildert haben mit dem Wasser, im digitalen Fall so an der Stelle nicht funktioniert, weil da kann man eben tatsächlich teilen, ohne dass man anderen etwas wegnimmt, wenn man Dinge kopiert.
Und diese Grundproblematik wird gerade jetzt in dieser Commoning-Szene massiv diskutiert und führt tatsächlich auch zu neuen Verfahren und Techniken, wie man versucht, mit diesen veränderten Situationen umzugehen. Gerade das Beispiel wären die Creative Commons, was eben der Versuch ist oder das Copyleft in einem Gegensatz zum Copyright, wo man ganz explizit Bezug nimmt auf bestehende Regelsysteme, die sich an der analogen Allmende orientieren, und diese versucht umzukehren oder an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
Und da ist man, vielleicht so ähnlich wie Rio minus 20, gerade jetzt erst an der Stelle, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie man diesen neu entstehenden Verteilungsraum tatsächlich anders strukturieren und nutzen kann. Und dieser Prozess hat gerade erst begonnen.
Leggewie: Machen Sie es doch bitte noch mal deutlich an dem Creative Commons. Das kennen ja nicht alle. Was ist daran das neue Prinzip?
Bieber: Ich kann nun als Autor eines Werkes selbst darüber verfügen, welche Urheberrechte ich gewissermaßen für mich behalten will, eigentlich alle, oder ich veräußere sie, ich überschreibe sie gewissermaßen in das Gemeingut, in die digitale Allmende, indem ich das Werk vollständig freigebe oder indem ich es in Teilen freigebe.
Man muss dann ins Kleingedruckte schauen, da steht dann öfter mal some rights reserved, also einige Rechte bleiben beim Autor. Aber es steht dem Autor frei, dass er sich eben nicht so strikt - wie nach dem klassischen Urheberrecht - komplett einer bestehenden Norm unterordnet, sondern er verfügt darüber. Er hat eine Möglichkeit, hier selbst zu bestimmen, welche Teile des Werkes frei bleiben, welche gewissermaßen in seiner eigenen Domäne bleiben, oder ob eben das Werk, das geschaffen wird, tatsächlich für alle gleichermaßen frei zu nutzen ist.
Edenhofer: Ich möchte noch mal gern zu dieser Wissens-Allmende. Sie haben völlig Recht, wir sollten nicht nur darüber reden, dass Allmenden übernutzt und auch unternutzt werden. Das hat eine sehr dramatische Wirkung, zum Beispiel bei Medikamenten. Wenn man heute ein Medikament herstellen wollte gegen Malaria, dann müsste man sehr viele Patente aufkaufen. Das Produkt herzustellen, kostet fast nichts, aber der Aufkauf der Patente, der kostet eine ganze Menge. Und es ist meistens unmöglich, die alle aufzukaufen.
Das heißt also: Privateigentum an Wissen kann dazu führen, dass wir die Wissens-Allmenden unternutzen, Dinge ungetan lassen, die wir eigentlich ohne Schwierigkeiten machen könnten, wenn das sozusagen wie eine Allmende organisiert wäre.
Das Gleiche gilt mit der Frage, ob also zum Beispiel die genetische Ausstattung der Welt patentiert werden kann. Was soll denn überhaupt Privateigentum sein? Und was darf denn überhaupt der privaten Nutzung zugeführt werden?
So gibt es also eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, wir müssten eigentlich diese Patente poolen und müssten sie der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und das zeigt eigentlich nur, dieses Unternutzungs- und Übernutzungsthema, dass der Begriff der Commons, der Gemeinschaftsgüter, eine unglaubliche Kraft hat, um zentrale Prozesse der Globalisierung zu analysieren.
Deutschlandradio Kultur: Herr Bieber, ist das eine neue politische Bewegung womöglich, der Commonismus?
Bieber: Na ja, zurzeit sicherlich noch eine sehr, sehr zerstreute, die sich an der einen oder anderen Stelle aber dann durchaus auch schon mal materialisieren kann.
Und Sie spielen vermutlich auf diese Piraten an, und das könnte in der Tat eine solche Strömung sein, bei der man – zumindest hier in Deutschland – Ansätze schon einer solchen Partei der Commons erkennen kann. Wenn es eben um Fragen der Netzpolitik geht, wo eben genau diese Verteilungsfragen eine große Rolle spielen, aber am Beispiel der Piraten sieht man, dass dieses Prinzip eigentlich das Entscheidende ist, und nicht ein bestimmtes Thema, wie jetzt das Urheberrecht, sondern das Prinzip ist das Relevante.
Wenn es den Piraten gelingt, deutlich zu machen, dass das Verteilungsprinzip auch in anderen Politikfeldern funktioniert, dann könnte das tatsächlich auch eine nachhaltige Entwicklung sein. Als Beispiel wäre das bedingungslose Grundeinkommen zu nennen, was eben auch in diese Richtung weist. Oder die Forderung nach einem fahrscheinlosen – nicht kostenlosen – fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr, was eben den Transport in Richtung dieser Allmende-Qualität rückt. Das könnte tatsächlich zu einer Bewegung werden, aber da ein festes Urteil abzugeben, ist natürlich auch noch zu früh.
Leggewie: Die andere Seite, Ihre Kolleginnen und Kollegen an den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühlen, nehmen die diese Gedanken jetzt zunehmend auf und vor allen Dingen wirtschaftliche Akteure, finden die das, was wir hier erzählen, Spinnerei oder nicht Commonismus, sondern Kommunismus? Hat das eine realistische Chance, dass sich ein solches Kooperationsprinzip, wie Sie es schildern, durchsetzt?
Edenhofer: Zunächst mal hat ja Elinor Ostrom den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Und das ist sicherlich ein Denken, das die große paradigmatische Kraft hat. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass sich solche Gedanken einer überwältigen Zustimmung erfreuen an den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühlen.
Es geht aber weniger um die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühle, sondern es geht darum, Sie haben das ja durch Ihre Konnotation zum Ausdruck gebracht – der Commonismus scheint auf den ersten Blick ein Angriff auf den Liberalismus zu sein. Und das ist eben dann die Frage, die wirklich wichtige Frage, die zu klären ist. Über welche Freiheit reden wir? Ist es die gleiche Freiheit aller? Und das muss geklärt werden.
Und ich denke, die Perspektive der Allmende hat aus meiner Sicht in keinerlei Weise irgendetwas damit zu tun, dass dort Akteure unterdrückt werden, dass Kreativität unterbunden wird. Was diese Form der Commons machen will, ist, Kreativität zu entfesseln.
Und im Übrigen ist es nicht so ganz – die Gedanken um die Commons sind ja nicht neu. Das haben Sie ja schon angeschnitten, die sind ja nicht durch Hardin erst erfunden worden. Das ist eigentlich – geht sogar zurück bis zu Thomas von Aquin, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf, das ist immerhin ein Kirchenvater der katholischen Kirche und revolutionärer Umtriebe unverdächtig. Der hat schon etwas gesagt, nämlich von der universalen Widmung der Erdengüter. Der war der Auffassung, dass zunächst mal die Welt, die Schöpfung, Gemeineigentum der Menschheit ist und dass sich das Privateigentum erst als die überlegene Ordnungsform erweisen muss. Und erst wenn klar ist, dass das besser ist als Gemeineigentum – Commons – und besser ist als staatliches Eigentum, dann machen wir Privateigentum und vice versa.
Leggewie: Gut, jetzt haben wir auch noch den Segen für dieses Prinzip. Karl Valentin hat gesagt: der Mensch ist gut, nur die Leut' sind schlecht. Herr Edenhofer, das wollen Sie uns noch erklären.
Edenhofer: Ja, also zunächst mal, das ist eine Kritik an den Intellektuellen, die gerne über den Menschen sprechen, aber dann schnell die Nase voll haben von den konkreten Leuten. Aber es ist auch so mit der Kooperation, der Mensch ist gut, der Mensch ist zur Kooperation befähigt. Er ist auch auf Kooperationen – ich würde sogar sagen – geschaffen. Aber natürlich, in allen in uns, es braucht auch die richtigen Anreize.
Also, man muss sozusagen diese hehre Prinzip, der Mensch will kooperieren, er ist die kooperative Spezies, das muss auch eingelöst werden durch sehr konkrete Anreize. Und da muss man auch damit rechnen, dass die konkreten Leute manchmal schlecht sind. Und damit muss auch jemand fertig werden, der für Kooperation eintritt.
Und Karl Valentin ist da ein guter Ratgeber, weil Karl Valentin ein gutes Gespür für dieses Skurrile und Abgründige hat. Und ohne dieses Gespür für das Skurrile und Abgründige kann man nicht sinnvoll streiten für globale Gemeingüter.
Leggewie: Und das war nämlich Ihr Buchtipp auch am Schluss dieser Sendung. Martin Maier: "Der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Mit Karl Valentin Sinn und Wahnsinn des Lebens entschlüsseln", im Herder Verlag erschienen.
Herr Bieber, ganz kurz noch, Sie haben auch noch einen Buchtipp.
Bieber: Ja, der schließt an das digitale Ende des Themas an. Es ist ein Buch von Douglas Coupland, einem kanadischen Romancier müsste man eigentlich sagen, der aber eine Biografie von Marshall McLuhan geschrieben hat, die sich ein bisschen unterscheidet von den Biografien, die man so kennt. Er hat Versatzstücke aus dem Netz eingesammelt, die in Bezug zu dieser Biografie gesetzt. Das ist, glaube ich, ganz spannend, einen Denker jetzt noch mal wieder zu lesen in einer neuen Perspektive, weil vielleicht gerade jetzt erst wir medial in die Richtung kommen, die er mit seinen Ideen vorausgeahnt hat. Und das von einem Autor, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit jungen Menschen der 90er- und 2000er-Jahre, mit einer bestimmten Kultur, die im Umfeld des Internet entstanden ist, auseinandergesetzt hat. Und dieser Crash of Cultures, der ist eigentlich sehr, sehr spannend.
Leggewie: Es geht voran. Wir haben die Bücher alle auf der Webseite von Deutschlandradio Kultur und beim Kulturwissenschaftlichen Institut und bei der Buchhandlung "Proust".
Das war "Lesart Spezial" in Deutschlandradio Kultur, aus dem Café Central im Schauspiel Essen, mit der Buchhandlung "Proust" und dem Medienpartner WAZ.
Besprochen haben wir sehr interessante Bücher – kaufen Sie diese Bücher! Es verabschiedet sich Claus Leggewie und wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag!
Weiterführende Links zum Thema:
Themenportal Rio+20
Die UN-Konferenz Rio+20
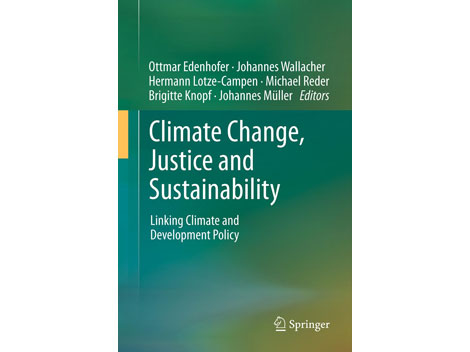
Buchcover "Climate Change, Justice and Sustainability" von Ottmar Edenhofer u.a.© Springer Verlag
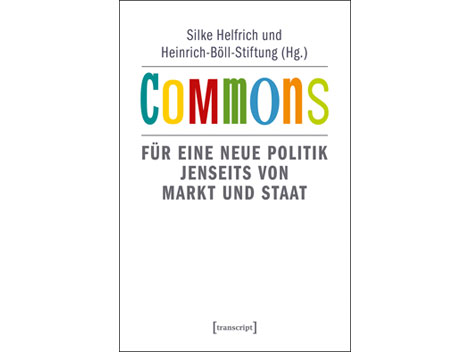
Buchcover "Commons" von Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung© transcript Verlag
