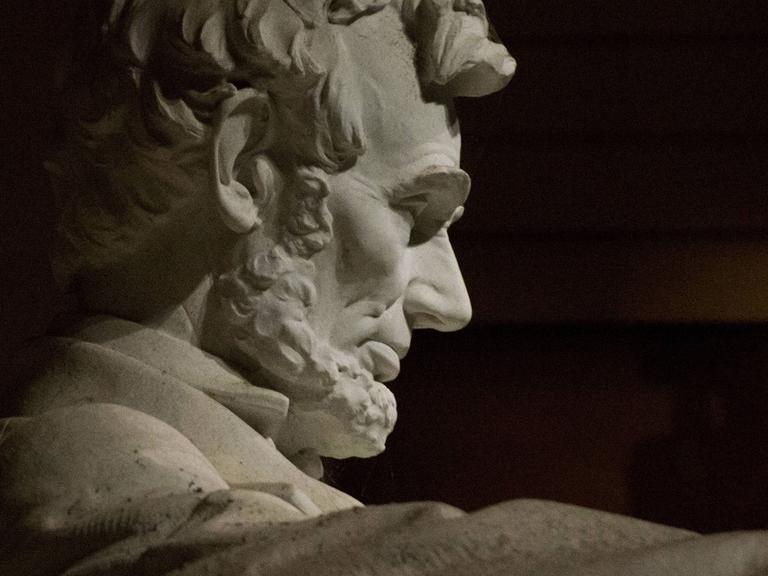Die Stunde der Rassentrennung

Von Martina Buttler · 05.01.2016
In den USA beten schwarze und weiße Christen fast immer getrennt. Die Rassentrennung ist im sonntäglichen Gottesdienst deutlich zu spüren. Auch der Stil der Feier unterscheidet sich deutlich. Eine Standortbestimmung.
Thad Cradle bläst in seine Trompete, reckt sie zur Kirchendecke der United Methodist Church in Richmond, Virginia. Er groovt. Der schwarze Musiker mit dem runden Gesicht und dem glatt rasierten Kopf geht auf die Knie, er spielt weiter, tanzt durch den Gang vor dem Altar. Das weiße Hemd unter den schwarzen Hosenträgern durchgeschwitzt. Die Fliege hängt an einer Seite runter. Reverend Rodney Hunter ist seit 29 Jahren Pfarrer hier. Der Mann im grauen Anzug tanzt ausgelassen zur Musik. Nicht nur wenn wie heute eine Shoutband spielt, sondern auch bei einem ganz normalen Gottesdienst, ist sich der Reverend sicher.
Man könnte ihn mit verbundenen Augen in eine Kirche stellen und er würde genau hören, ob er in einem hauptsächlich schwarzen oder weißen Gottesdienst steht. Die Unterschiede sind ganz klar zu hören und zu spüren, meint der Reverend:
"Also bei uns, da kommen bei der Predigt auch schon mal Kommentare: Ja, Pfarrer, predige weiter. Es ist frei. Und jeder kann mitmachen, wie er sich halt gerade fühlt. In weißen Kirchen macht die Gemeinde wenig mit - außer beim Wechselgebet zum Beispiel. Ich lese den Text, ihr antwortet. Aber in schwarzen Kirchen geht es um die Spontanität. Und für mich ist das ein großer Unterschied."
Und die Themen sind andere. Wenn Reverend Hunter sonntags auf die hölzerne Kanzel in seiner Kirche steigt, spricht er andere Dinge an, als sein Kollege in der weißen Kirche ein paar Kilometer weiter. Das, was das Leben in seiner Gemeinde prägt: Arbeitslosigkeit, Armut, Männer im Gefängnis, Schulden, Unterdrückung. In die Kirche an der Durchgangsstraße kommen hauptsächlich Schwarze. Die Gemeindemitglieder heben immer wieder mal die Hände. Zeigen mit einem Finger zum Himmel und nicken zustimmend. Der Herr dort oben, er wird es richten.
"Wie kommt es, dass wir alle so viel mehr hasserfüllte Worte und Schimpfworte kennen, als Worte der Liebe? Sagt's mir, ihr verflucht doch alle jede Minute jemanden. Aber es ist so schwer, zu sagen: Es tut mir leid. Ist doch bei Euch auch so. Jeder denkt sich: Eher gehe ich in die Hölle, als dass ich mich entschuldige."
Und diesen anderen Stil kann man auch hören, weiß der Reverend mit den kurzen grauen Bartstoppeln und dem gutgelaunten Lächeln:
"Man kann den Unterschied auch beim Singen hören. Weiße singen so: Und bei Schwarzen klingt das gleiche Lied so ..."
Auch wie man sich für die Kirche kleidet, macht den Unterschied. Die Frauen in einer vornehmlich schwarzen Gemeinde holen wirklich ihr "Sunday Best" ihr schönstes Kleid aus dem Schrank. Hochhackige Schuhe, große Hüte, aufwändiges Make-up – eine Augenweide. So gehen sie zur Kirche. Die Männer im Anzug. Auch rein optisch andere Welten, meint Cheryl:
"Ich denke, dass Schwarze sich wirklich schick machen, wenn sie in die Kirche gehen. Das kommt noch aus den Zeiten der Sklaverei. Es gab Kleidung für die Arbeit im Feld. Und wir wollen Gott unser Bestes geben. Und unser Bestes heißt: wir schmücken uns für Gott raus, wenn wir sonntags in die Kirche gehen."

Musikalische Begleitung im Gottesdienst© Foto: Martina Buttler / ARD
Die Gottesdienste sind wirklich grundverschieden, dem stimmt der weiße Reverend Reggie Tuck zu. Der Mann mit den grauen kurzen Haaren und der schmal umrandeten Brille ist auch Pfarrer einer Methodistengemeinde. Allerdings sind seine Gemeindemitglieder in Springfield, Virginia wie er größtenteils weiß. Tuck hat selbst in seinem Vikariat ein Jahr lang in einer schwarzen Gemeinde gearbeitet:
"Für die meisten Besucher eines weißen Gottesdienstes findet das Erlebnis zwischen den Ohren statt. Es ist eher eine intellektuelle Erfahrung, nicht sehr emotional. Als ich in der afroamerikanischen Gemeinde gearbeitet habe, habe ich ganz andere Gottesdienst-Dimensionen kennengelernt. Und die Gemeinde hat eingefordert, dass ich mich mehr persönlich einbringe, als ich das in einer traditionell weißen Gemeinde getan hätte."
Drei Gottesdienste feiert Pastor Tuck jeden Sonntagmorgen in seiner beigefarbenen Backsteinkirche. Das weiße Dach sieht von innen aus wie ein Tipi mit dunkelbraunen großen Holzstreben. Die Gemeindemitglieder stehen auf Anweisung zum Gebet oder zum Segen auf. Den Rest der Zeit sitzen sie weitestgehend still in den langen Holzbänken des hellen runden Kirchenraums.
Tim Pemberton ist seit 22 Jahren Gemeindemitglied in der Messiah United Methodist Church in Springfield. Er fühlt sich hier im Gottesdienst Zuhause:
"Ich komme aus dem Mittleren Westen, bin eher ein zugeknöpfter Typ. Ich will keine Show machen. Ich genieße schöne Musik. Aber ich bin nicht der Typ, der im Gang tanzt."
Oren und Wendy Hatton haben mehrere Kirchen ausprobiert, als sie nach Springfield gezogen sind. Er ist weiß, sie schwarz und was sie wollten, bringt der Mann mit dem schütterer werdenden Haar und dem freundlichen Lächeln auf den Punkt:
"Als wir eine Kirche gesucht haben, wollten wir keine Gemeinde, wo meine Frau die einzige Schwarze ist. In der ersten Kirche in der wir waren, hat uns niemand begrüßt, niemand hat mit uns geredet. Wir haben einen Schwarzen gesehen, der im Chor gesungen hat. Als wir gegangen sind, hat wieder keiner mit uns geredet. Na ja, da haben wir gedacht: Den einen Quoten-Schwarzen, den sie haben wollten, den haben sie schon."
In der Messiah-Gemeinde machten sie andere Erfahrungen. Hier wurden sie begrüßt. Es gab schon vor Jahren eine Handvoll schwarze Gemeindemitglieder. Also sind sie geblieben. Und Wendy und Oren hoffen auf mehr Multikulti in ihrer Gemeinde. Dass Schwarze und Weiße meist nicht nebeneinander beten und singen, geht weit zurück. Die Wurzeln seiner Kirche reichen bis in die Zeit der Sklaverei zurück, erzählt Reverend Michael Bell. Er steht der Allen Chapel in Anacostia vor. Sie gehört zur African Methodist Episcopal Church, kurz AME:
"Eines Sonntags sind unsere Gründer in die Kirche gegangen und sie war überfüllt. Damals musste man als Schwarzer weichen, wenn ein Weißer keinen Platz fand. Richard Allen und Absalom Jones und ein paar andere waren auf ihren Knien und haben gebetet. Und die Platzanweiser haben sie aufgefordert, Platz zu machen. Und sie haben gesagt: Lassen sie uns bitte zu Ende beten, dann gehen wir, kein Problem. Das haben die Platzanweiser aber nicht mitgemacht. Also sind sie gegangen und haben ihre eigene Kirche aufgemacht in einer Schmiede."
Das war 1787 in Philadelphia. Damals war die Bibel auch ein Mittel der Macht:
"Viele konnten nicht lesen. Man konnte ihnen alles Mögliche erzählen. Die Bibel und der Gottesdienst wurden benutzt, um Menschen zu kontrollieren."
Wenn der charismatische schwarze Pfarrer Bell in der Allen Chapel vor seine Gemeinde tritt, spricht er über das, was die Menschen in diesem ärmsten Teil von Washington betrifft. Direkt hinter der großen Kirche mit dem lilafarbenen Teppich und dem reichlich geschmückten Altarraum sind Sozialwohnungen. Und wenn Pastor Bell predigt, predigt er über den Alltag derer, die hier leben:
"Unser Land braucht Heilung. Hier bei uns im Bezirk sind diese Woche Montagabend neun Schießereien gewesen."
Seit zehn Jahren arbeitet er in dieser Gemeinde und heute ist manches anders als damals:
"Seit ich hier angekommen bin, hat sich eins massiv verändert: das Verhältnis zwischen schwarz und weiß in diesem Land. Vor zehn Jahren war es nicht so negativ wie heute. Der Rassismus ist so fortgeschritten, dass man manchmal meint, man ist wieder in den 50er-, 60er-Jahren. Das hat sich sehr verändert."
Cheryl hat den Rassismus zwei Stunden südlich von Washington am eigenen Leib erlebt. Sie hatte jahrzehntelang ein Grundstück, nur das Geld zum Bauen fehlte. Außer Rasenmähen hat sie nicht viel gemacht. Ihr Verhältnis zu ihrem weißen Nachbarn: kein Problem. Als sie 2000 dann endlich anfängt, ihr Haus zu bauen, ändert sich das schlagartig:
"Mein Nachbar an der Ecke ist Rassist – ich kann es nicht anders sagen. Als ich angefangen habe zu bauen, hat er sein wahres Ich gezeigt. Er hat meine Bauarbeiter bedroht. Er hat beim Amt angerufen und erfolglos versucht, mich anzuschwärzen. Als ich einzog, hat er nicht eine, nicht zwei, nein drei Südstaatenflaggen gehisst. Als ich die Zufahrtsstraße teeren lassen will, schmeißt er Steine nach meinen Bauarbeitern. Die sind raus und hinter ihm her und ich stehe da und denke mir: ich kann nicht glauben, dass das alles gerade passiert."
Der Rassenhass ist tief verankert. Und nur so lässt sich auch ansatzweise das Attentat in einer schwarzen Kirche in Charleston, South Carolina erklären. Ein 21-jähriger weißer Mann besucht im Juni erst die Bibelstunde und erschießt dort später neun Menschen. Die Unfassbarkeit sitzt den Pastoren und ihren Gemeinden in den ganzen USA in den Knochen. So auch Reverend Michael Bell aus Anacostia:
"Wir waren am Boden zerstört wegen Charleston. Es hat keinen Einfluss darauf, wie wir unsere Gottesdienste feiern. Einige aus meinem Team wolltenüber eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen nachdenken. Ich habe gesagt: Nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr ängstlich in die Kirche kommt. Ich will, dass ihr euch hier frei fühlt."
Die AME-Kirche hat nach Charleston jeder Gemeinde ein Papier geschickt mit zwölf Sicherheitsregeln, die sie beachten sollen. Dazu gehört: einen Sicherheitsplan entwerfen, die Kommunikation verbessern, die Polizei vor Ort persönlich zu kennen. Ein- und Ausgänge mit Kameras überwachen. Auch Michael Bell hat mit seinem Team diese Ratschläge diskutiert. Viele setzen sie sowieso schon um und sie wollen sich nicht in ihrer Kirche wie in einer Festung verbarrikadieren. Auch der Chef des Sicherheitsteams, Malcolm Drewer will dem Attentäter nicht die Macht einräumen, sein Leben und seinen Glauben zu verändern:
"Ich sehe das als Einzelfall. Ein junger weißer Mann hat sich zu dieser Tat entschlossen. So viele Schwarze und Weiße haben so hart dafür gekämpft, uns zusammenzubringen. Wenn wir jetzt unser Leben verändern, dann hätte er gewonnen."
Dass nun besonders Kirchen zur Zielscheibe werden, glaubt Malcolm Drewer nicht:
"Ich werde mir von dem keine Angst einflößen lassen. Er wird nicht verändern, wie ich bete und Gott preise. Ich mache mir keine Sorgen, ob ich hier erschossen werde. Sowas kann überall passieren, ob im Kino oder im Stadion."
Die Psychologie hinter den getrennten Gottesdiensten für Schwarze und Weiße, bringt Oren Hatton auf den Punkt:
"Das Schöne daran, mit Leuten zusammenzukommen, die aussehen wie man selbst, ist, dass man viele Dinge nicht erklären muss. Man kann sich entspannen. Man muss nicht dies oder das verteidigen oder sich erklären. Für manche Leute ist sowas unbequem."
Und sein Pfarrer Reggie Tuck sieht hier den Ansatzpunkt für Veränderungen:
"Wenn man in seinen eigenen Kreisen bleibt, ist es bequem. Aber dabei verpassen wir Möglichkeiten. Mit der Vielfalt kommen Verlegenheit, Herausforderungen und Unbehagen. Aber nur wenn ich mich dem stelle, kann ich wachsen."
Und Oren Hatton meint, dass man sich in den USA erstmal von einer Vorstellung verabschieden muss:
"Wir haben in den USA diesen Mythos, ein Melting Pot zu sein. Das Zusammenschmelzen beginnt vielleicht so ein bisschen am Rand, aber im Zentrum wohl weniger."
Ruth Kindel hat die Zeiten erlebt, als Martin Luther King lebte und predigte. Die feine, grauhaarige schwarze Dame ist skeptisch, was das Ende des Rassismus und der Rassentrennung angeht:
"Ich werde nicht lange genug leben, um das zu erleben. Ich bin 80 und ich habe so viel Miteinander erlebt, wie es in meinem Leben wohl geben wird. Ich hoffe, dass Sie es erleben. Aber ob es uns jemals gelingt die Rassentrennung vollständig aufzulösen? Ich hoffe, dass es langsam aber sicher gelingt."
Und bis dahin beten und singen sonntagsmorgens in den USA schwarze und weiße Christen auf ihre eigene Art.