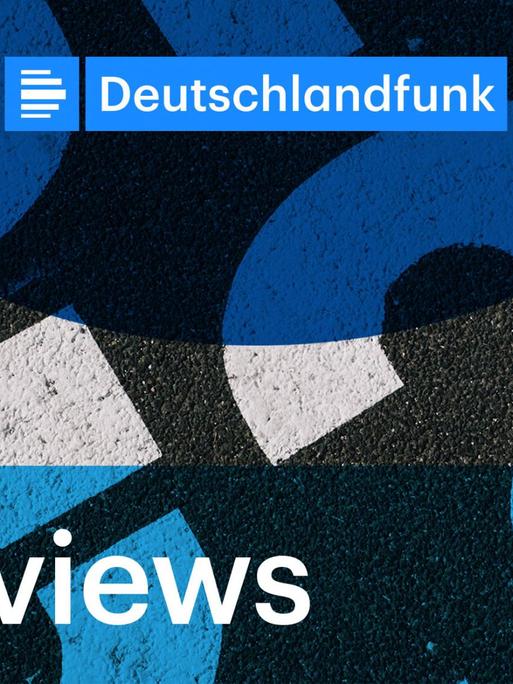Honeckers Partnerwahl
Moderation: Matthias Hanselmann · 30.08.2012
Nach neuen Erkenntnissen soll DDR-Chef Erich Honecker vor 1989 von einer Föderation beider deutscher Staaten geträumt haben - mit dem damaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine als Kanzler der Bundesrepublik. Der hält diese Gedankenspiele heute für "reine Spekulation".
Matthias Hanselmann: Zum 100. Geburtstag von Erich Honecker, ehemals Staatschef der DDR, überraschte vor ein paar Tagen der Historiker Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, mit der Nachricht, dass Honecker vor 1989 möglicherweise von einer Föderation der beiden deutschen Staaten träumte: mit dem Saarländer Oskar Lafontaine als Kanzler der Bundesrepublik und mit ihm, der ebenfalls aus dem Saarland stammte, als Chef der DDR. Und tatsächlich standen damals die Chancen, dass Lafontaine Kanzler wird, nicht schlecht. Zunächst jedenfalls. Dann kam für viele überraschend der Zusammenbruch der DDR.
Ich habe vor der Sendung mit Oskar Lafontaine gesprochen und ihn gefragt, ob es ihn überrascht habe, dass der Historiker Sabrow meint, Honecker habe sich eine deutsch-deutsche Konföderation vorstellen können - unter Lafontaine im Westen und Honecker im Osten?
Oskar Lafontaine: Ja, es hat mich etwas überrascht. Auf der anderen Seite ist das Wort von der Konföderation in der damaligen Diskussion ja öfters gefallen, unter anderem auch von Helmut Kohl. Insofern ist es wiederum nicht so überraschend, dass auch Honecker darüber nachgedacht hat. Und wahrscheinlich ist damit gemeint, dass im Jahr 1990, bevor klar wurde, wie die Dinge sich entwickeln werden, Helmut Kohl nach den Befragungen kaum noch Chancen hatte, wiedergewählt zu werden, und ich war damals Kanzlerkandidat der SPD. Erst als die Mauer fiel, drehte sich das Los und der Kanzler der Einheit war nicht mehr zu schlagen.
Hanselmann: Wir erinnern uns: Zwischen 1982 und 89 sind Sie offiziell neun Mal mit Honecker zusammengetroffen. Wie offen und frei konnte man eigentlich mit Honecker über Dinge reden, die zum Beispiel die Zukunft betrafen, die deutsch-deutsche Zukunft?
Lafontaine: Offen und frei konnte man mit ihm reden über die Dinge, die er glaubte, mit mir besser besprechen zu können als mit anderen, beispielsweise die Entwicklung im Saarland, seine saarländische Heimat, seine Herkunft, die historischen Bezüge, die sich damit verbanden. Da war er sehr offen und sehr unbefangen. Sobald es in die sogenannte hohe Politik ging, war er natürlich vorsichtiger.
Ich war damals als Ministerpräsident verpflichtet, einiges zu tun, um die Interessen des Saarlandes zu vertreten. Es gab daher Fortschritte bei den wirtschaftlichen Beziehungen. Das Ganze war aber auch ein Teil der Deutschland-Politik, so wie wir sie damals im Zuge der Entspannungspolitik Willy Brandts verstanden. Es gab auch regen kulturellen Austausch und sportlichen Austausch. Das waren die Hauptthemen auch der damaligen Begegnung.
Hanselmann: Er kam ja nach außen hin recht spröde, sage ich mal vorsichtig, rüber. Wie war Erich Honecker im persönlichen Gespräch: lockerer, offener, gelassener?
Lafontaine: Im persönlichen Gespräch war er lockerer, offener und gelassener. Ich habe manchmal im Freundeskreis gesagt, er wirkt auf mich wie ein abgeklärter Hüttenpensionär oder Bergmann. Das stellt er ab auf seine saarländische Herkunft. Er wirkte also entspannt im Vier-Augen-Gespräch. Und da ging es ja, wie gesagt, nicht nur um die großen Themen der Weltpolitik.
Hanselmann: Sie haben damals, 1987, auch mal gesagt: Wie alle Saarländer kann er auch alle Fünfe gerade sein lassen. Was bedeutete das denn konkret?
Lafontaine: Das bedeutete, dass er eben zu Kompromissen bereit war, wenn wir darüber geredet haben, ob es Städtepartnerschaften geben könnte. Er wusste ja um die Schwierigkeiten, die auch Herr Sabrwo angedeutet hat: Jede Öffnung hat natürlich das Risiko beinhaltet, dass das System der DDR destabilisiert wurde, das war ja, wenn man so will, der dialektische Prozess. Es war natürlich der Wunsch der DDR-Führung, durch die Öffnung letztendlich doch das eigene System zu stabilisieren, aber das ist ja dann letztendlich nicht gelungen.
Hanselmann: Lassen Sie uns doch kurz mal hören, was Herr Sabrow anlässlich des 100. Geburtstages von Erich Honecker hier im Deutschlandradio Kultur im "Radiofeuilleton" sagte über die besondere Lage, in der sich Honecker und die DDR damals, 1988, 89, befanden:
Martin Sabrow: Gefangen zwischen einem Moskauer Rückhalt, der immer schwächer wurde, gezwungen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, sich nach dem Westen zu öffnen, und gleichzeitig in voller Erkenntnis, dass diese Westöffnung natürlich auch zu einer Erosion der eigenen Legitimationsgrundlagen führen würde … In dieser Situation brauchte Honecker die wirtschaftliche Verbindung und er brauchte die Hoffnung auf politische Zugeständnisse.
Hanselmann: Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Lafontaine, Erich Honecker hat signalisiert, enger mit der Bundesrepublik zusammenarbeiten zu wollen. Kein Wunder, die DDR war wirtschaftlich am Ende. Wie haben Sie in der SPD-Spitze diese Signale wahrgenommen und ausgewertet, auch die Tatsache, dass Honecker und die DDR von Gorbatschow ja zum Teil fallen gelassen worden sind?
Lafontaine: Ja, wir haben diese Signale aufgenommen und haben sie ausgewertet im Sinne praktischer Politik. Auf meiner Ebene war das eben so, dass ich alles versucht habe als Ministerpräsident, im weitesten Sinne eine Zusammenarbeit, einen Austausch mit der DDR zu organisieren. Das stieß natürlich immer wieder an die Grenzen der Befürchtung, dass eine zu weitgehende Zusammenarbeit die Macht der SED destabilisieren könnte. Aber im Rahmen dessen, was Honecker und was die damalige DDR-Führung für möglich hielten, kam es dann immer wieder zu Fortschritten.
Hanselmann: Sie waren im SPD-Vorstand verantwortlich für das künftige SPD-Programm, Sie wurden als Kanzlerkandidat gehandelt, später wurden Sie das ja auch, Sie haben es eben erwähnt. Hätte die Bundestagswahl 1990 regulär stattgefunden und Sie wären an die Macht gekommen, hätten Sie ja handeln müssen. Welche Vorstellungen gab es denn damals in der SPD-Spitze, was wurde im Parteivorstand diskutiert?
Lafontaine: Es gab einen strittigen Punkt, der ja auch in der Presse eine große Rolle gespielt hat: Ich habe damals dafür plädiert, die Staatsbürgerschaft der DDR anzuerkennen unter der Bedingung – das wurde dann in der westdeutschen Presse ständig unterschlagen –, dass damit absolute Reisefreiheit verbunden sein würde. Das war beispielsweise ein Thema.
Ich würde heute auch noch nicht in der Lage sein, zu beurteilen, ob die SED-Führung das tatsächlich gemacht hätte, aber es war eine Diskussion. Denn immer dann, wenn wir von den Verantwortlichen der DDR angesprochen worden sind, warum Pässe der DDR nicht akzeptiert werden, warum dies oder jenes nicht geschehe, haben wir geantwortet, dann lasst uns doch endlich die Dinge insoweit normalisieren als wir eben die Staatsbürgerschaft anerkennen, aber gleichzeitig dafür die Reisefreiheit bekommen. Denn das war ja das große Anliegen der Menschen in der DDR, das ich bei meinen Besuchen immer wieder gehört habe, dass sie nicht frei reisen konnten.
Hanselmann: Honecker wollte, dass die Staatsbürgerschaft der DDR durch die Bundesrepublik anerkannt werden sollte. Hat er denn einmal angedeutet, dass man diese Anerkennung der Staatsbürgerschaft sozusagen gegen die Mauer tauschen könnte?
Lafontaine: Das wäre ja, wenn Sie so wollen, etwas Ähnliches gewesen, die Reisefreiheit. Denn das war ja ein ganz wichtiges Thema und deshalb habe ich es immer wieder vorgebracht in meinen Gesprächen mit der DDR-Führung, weil dagegen schwer zu argumentieren war. Wer also – und das war ja so – mir gegenüber vertreten hat, dass der eigene Staat auch von den eigenen Bürgern getragen werde, der konnte schlecht argumentieren, warum er die eigenen Bürger nicht frei reisen lassen konnte. Und das war eben ein Thema, das ich besonders gerne und immer wieder angesprochen habe, weil es logisch zwingend war. Ob es möglich gewesen wäre, diesen Durchbruch zu erreichen, ist heute natürlich reine Spekulation, aber es war ein wichtiges Thema.
Hanselmann: Diese Konstruktion, die da in den letzten Tagen in der Presse natürlich etwas plakativ beschrieben wurde, Sie als Bundeskanzler, Honecker als DDR-Staatsratsvorsitzender in zwei deutschen Staaten, die eng miteinander verflochten sind: Hätten Sie das damals für denkbar gehalten?
Lafontaine: Das kann man heute natürlich nicht sagen, wie weit die Verflechtung wirklich gegangen wäre. Das einzige Besondere bei einer solchen Konstellation wäre gewesen, dass von vornherein ein besseres, wenn man so will, Verständnis vorhanden gewesen wäre, weil wir nun beide aus demselben sozialen Umfeld kommen, dem sozialen und kulturellen Umfeld einer Grenzregion wie das Saarland hier ist, das geprägt war von der Industriekultur. Aber darüber hinausgehend zu spekulieren, das halte ich dann doch nicht für angemessen.
Jeder wäre ja eingebunden gewesen in die politischen Rahmenbedingungen, unter denen zu operieren gewesen wäre. Aber es ist nun einmal so in der Politik, wenn das menschliche Verständnis einigermaßen ist, dann lässt sich natürlich auch Schwierigeres leichter behandeln.
Hanselmann: So wie Historiker Martin Sabrow sagt, dass Ihr gemeinsamer spezieller Saarpatriotismus und Ihre grundsätzlich ähnlichen sozialistischen Vorstellungen eine solche Kooperation hätten möglich machen können?
Lafontaine: Ja nun, mit den grundsätzlich ähnlichen sozialistischen Vorstellungen, das ist natürlich so eine Sache. Ich habe in den Gesprächen mit der DDR-Führung wahrscheinlich offener gesprochen, was diesen Punkt angeht, als viele meiner Kollegen Ministerpräsidenten oder Politiker, die damals mit der DDR-Führung Kontakt hatten, wahrscheinlich auch, weil sie sich mit dieser Frage nie auseinandergesetzt haben.
Ich habe beispielsweise wörtlich immer gesagt, dass ein Mehrparteiensystem vorteilhafter ist und eine wirtschaftliche Ordnung, wie wir sie haben, als die der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist ja unmittelbar einsehbar, wenn man sich vorstelle, wer von der SED ausgeschlossen sei oder nicht mehr akzeptiert werde, habe in diesem Staat keine Chance mehr. Aber wer in der Bundesrepublik beispielsweise bei Mercedes in Ungnade fiel, der könnte ja immer noch zu BMW gehen, und wenn er dort in Ungnade fiel, dann könnte er immer noch zu VW gehen.
Das heißt, ich habe die Pluralität der Machtverteilung in den Vordergrund meiner politischen Vorstellungen gestellt, und dies stieß sicherlich nicht unbedingt auf offene Ohren in der damaligen DDR-Führung. Aber es war einfach notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Sozialismus für mich und für viele, die im Westen über Sozialismus sprachen, nichts anderes war als bis zum Ende gedachte Demokratie.
Hanselmann: Sie mussten sich damals auch von eigenen Parteigenossen, auch prominenten, vorwerfen lassen, Sie wollten die staatliche Einheit verhindern und hätten kein eigenes Konzept für den Einigungsprozess gehabt. Wie sehen Sie das jetzt, über 20 Jahre später?
Lafontaine: Ja, das ist ein ganz normaler Vorgang in innerparteilichen Auseinandersetzungen. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, solche Tabus wie die Staatsbürgerschaft anzusprechen, führte natürlich in der damaligen Zeit zu neurotischen Reaktionen in der SPD-Führung. Den eigentlichen Kontext unter der Bedingung, dass Reisefreiheit gewährt wurde, hat man gar nicht mehr gesehen und vielleicht auch gar nicht die Bedeutung erkannt.
Hanselmann: Es war ja letztlich die Bevölkerung der DDR beziehungsweise die Bewegung "Wir sind das Volk", die den Wandel 1989 beschleunigte und die Wende herbeiführte. Haben Sie in dieser Geschwindigkeit und in dieser Wucht damit gerechnet?
Lafontaine: Nein. Ich habe wie viele andere nicht geglaubt, dass Moskau die DDR aus ihrem Einflussbereich entlassen würde. Das war ja, wenn man so will, das große historische Verdienst Gorbatschows. Und ich habe das auch nicht rechtzeitig erkannt, das muss ich sagen. Aber als dann die Parole "Wir sind das Volk" gerufen wurde, dann war das ja genau das, was dem Sozialismus fehlte oder dem DDR-Sozialismus fehlte. Es ist nun einmal so: Sozialismus ist zu Ende gedachte Demokratie und der Ruf "Wir sind das Volk" war, wenn man so will, eine sozialistische Parole, die eben bei den Vertretern des Staatssozialismus wohl zu lange auf taube Ohren gestoßen ist.
Hanselmann: Sollte diese Parole heutzutage öfter wieder gerufen werden?
Lafontaine: Ja, selbstverständlich. Denn wir sind ja noch lange nicht in einer demokratischen Gesellschaft angekommen. Denn Demokratie ist nach Perikles eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und insofern haben wir allen Grund, unsere Gesellschaften kritisch zu hinterfragen und uns nicht darauf auszuruhen, wenn man so will, mit Zufriedenheit festzustellen, dass der Staatssozialismus eine verfehlte Gesellschaftsordnung war.
Demokratie heißt eben, die Interessen der Mehrheit setzen sich durch. Und wenn Löhne fallen, Renten sinken und soziale Leistungen gekürzt werden, kann ja nur noch jemand, der denkunfähig ist, behaupten, dass sei eine demokratische Gesellschaft!
Hanselmann: Herr Lafontaine, ganz, ganz herzlichen Dank!
Lafontaine: Gern geschehen!
Hanselmann: Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, Oskar Lafontaine, Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 1990, Ex-SPD-Chef, ehemaliger, langjähriger Ministerpräsident des Saarlandes und jetzt Oppositionsführer für die Linke eben dort.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Mehr zum Thema:
Geschichte aktuell: Grenzüberschreitungen
Vor 25 Jahren: Das SED-SPD-Ideologiepapier (DLF)
"Bis zuletzt uneinsichtig"
Zum 100. Geburtstag von Erich Honecker (DLF)
Ich habe vor der Sendung mit Oskar Lafontaine gesprochen und ihn gefragt, ob es ihn überrascht habe, dass der Historiker Sabrow meint, Honecker habe sich eine deutsch-deutsche Konföderation vorstellen können - unter Lafontaine im Westen und Honecker im Osten?
Oskar Lafontaine: Ja, es hat mich etwas überrascht. Auf der anderen Seite ist das Wort von der Konföderation in der damaligen Diskussion ja öfters gefallen, unter anderem auch von Helmut Kohl. Insofern ist es wiederum nicht so überraschend, dass auch Honecker darüber nachgedacht hat. Und wahrscheinlich ist damit gemeint, dass im Jahr 1990, bevor klar wurde, wie die Dinge sich entwickeln werden, Helmut Kohl nach den Befragungen kaum noch Chancen hatte, wiedergewählt zu werden, und ich war damals Kanzlerkandidat der SPD. Erst als die Mauer fiel, drehte sich das Los und der Kanzler der Einheit war nicht mehr zu schlagen.
Hanselmann: Wir erinnern uns: Zwischen 1982 und 89 sind Sie offiziell neun Mal mit Honecker zusammengetroffen. Wie offen und frei konnte man eigentlich mit Honecker über Dinge reden, die zum Beispiel die Zukunft betrafen, die deutsch-deutsche Zukunft?
Lafontaine: Offen und frei konnte man mit ihm reden über die Dinge, die er glaubte, mit mir besser besprechen zu können als mit anderen, beispielsweise die Entwicklung im Saarland, seine saarländische Heimat, seine Herkunft, die historischen Bezüge, die sich damit verbanden. Da war er sehr offen und sehr unbefangen. Sobald es in die sogenannte hohe Politik ging, war er natürlich vorsichtiger.
Ich war damals als Ministerpräsident verpflichtet, einiges zu tun, um die Interessen des Saarlandes zu vertreten. Es gab daher Fortschritte bei den wirtschaftlichen Beziehungen. Das Ganze war aber auch ein Teil der Deutschland-Politik, so wie wir sie damals im Zuge der Entspannungspolitik Willy Brandts verstanden. Es gab auch regen kulturellen Austausch und sportlichen Austausch. Das waren die Hauptthemen auch der damaligen Begegnung.
Hanselmann: Er kam ja nach außen hin recht spröde, sage ich mal vorsichtig, rüber. Wie war Erich Honecker im persönlichen Gespräch: lockerer, offener, gelassener?
Lafontaine: Im persönlichen Gespräch war er lockerer, offener und gelassener. Ich habe manchmal im Freundeskreis gesagt, er wirkt auf mich wie ein abgeklärter Hüttenpensionär oder Bergmann. Das stellt er ab auf seine saarländische Herkunft. Er wirkte also entspannt im Vier-Augen-Gespräch. Und da ging es ja, wie gesagt, nicht nur um die großen Themen der Weltpolitik.
Hanselmann: Sie haben damals, 1987, auch mal gesagt: Wie alle Saarländer kann er auch alle Fünfe gerade sein lassen. Was bedeutete das denn konkret?
Lafontaine: Das bedeutete, dass er eben zu Kompromissen bereit war, wenn wir darüber geredet haben, ob es Städtepartnerschaften geben könnte. Er wusste ja um die Schwierigkeiten, die auch Herr Sabrwo angedeutet hat: Jede Öffnung hat natürlich das Risiko beinhaltet, dass das System der DDR destabilisiert wurde, das war ja, wenn man so will, der dialektische Prozess. Es war natürlich der Wunsch der DDR-Führung, durch die Öffnung letztendlich doch das eigene System zu stabilisieren, aber das ist ja dann letztendlich nicht gelungen.
Hanselmann: Lassen Sie uns doch kurz mal hören, was Herr Sabrow anlässlich des 100. Geburtstages von Erich Honecker hier im Deutschlandradio Kultur im "Radiofeuilleton" sagte über die besondere Lage, in der sich Honecker und die DDR damals, 1988, 89, befanden:
Martin Sabrow: Gefangen zwischen einem Moskauer Rückhalt, der immer schwächer wurde, gezwungen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, sich nach dem Westen zu öffnen, und gleichzeitig in voller Erkenntnis, dass diese Westöffnung natürlich auch zu einer Erosion der eigenen Legitimationsgrundlagen führen würde … In dieser Situation brauchte Honecker die wirtschaftliche Verbindung und er brauchte die Hoffnung auf politische Zugeständnisse.
Hanselmann: Martin Sabrow, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Lafontaine, Erich Honecker hat signalisiert, enger mit der Bundesrepublik zusammenarbeiten zu wollen. Kein Wunder, die DDR war wirtschaftlich am Ende. Wie haben Sie in der SPD-Spitze diese Signale wahrgenommen und ausgewertet, auch die Tatsache, dass Honecker und die DDR von Gorbatschow ja zum Teil fallen gelassen worden sind?
Lafontaine: Ja, wir haben diese Signale aufgenommen und haben sie ausgewertet im Sinne praktischer Politik. Auf meiner Ebene war das eben so, dass ich alles versucht habe als Ministerpräsident, im weitesten Sinne eine Zusammenarbeit, einen Austausch mit der DDR zu organisieren. Das stieß natürlich immer wieder an die Grenzen der Befürchtung, dass eine zu weitgehende Zusammenarbeit die Macht der SED destabilisieren könnte. Aber im Rahmen dessen, was Honecker und was die damalige DDR-Führung für möglich hielten, kam es dann immer wieder zu Fortschritten.
Hanselmann: Sie waren im SPD-Vorstand verantwortlich für das künftige SPD-Programm, Sie wurden als Kanzlerkandidat gehandelt, später wurden Sie das ja auch, Sie haben es eben erwähnt. Hätte die Bundestagswahl 1990 regulär stattgefunden und Sie wären an die Macht gekommen, hätten Sie ja handeln müssen. Welche Vorstellungen gab es denn damals in der SPD-Spitze, was wurde im Parteivorstand diskutiert?
Lafontaine: Es gab einen strittigen Punkt, der ja auch in der Presse eine große Rolle gespielt hat: Ich habe damals dafür plädiert, die Staatsbürgerschaft der DDR anzuerkennen unter der Bedingung – das wurde dann in der westdeutschen Presse ständig unterschlagen –, dass damit absolute Reisefreiheit verbunden sein würde. Das war beispielsweise ein Thema.
Ich würde heute auch noch nicht in der Lage sein, zu beurteilen, ob die SED-Führung das tatsächlich gemacht hätte, aber es war eine Diskussion. Denn immer dann, wenn wir von den Verantwortlichen der DDR angesprochen worden sind, warum Pässe der DDR nicht akzeptiert werden, warum dies oder jenes nicht geschehe, haben wir geantwortet, dann lasst uns doch endlich die Dinge insoweit normalisieren als wir eben die Staatsbürgerschaft anerkennen, aber gleichzeitig dafür die Reisefreiheit bekommen. Denn das war ja das große Anliegen der Menschen in der DDR, das ich bei meinen Besuchen immer wieder gehört habe, dass sie nicht frei reisen konnten.
Hanselmann: Honecker wollte, dass die Staatsbürgerschaft der DDR durch die Bundesrepublik anerkannt werden sollte. Hat er denn einmal angedeutet, dass man diese Anerkennung der Staatsbürgerschaft sozusagen gegen die Mauer tauschen könnte?
Lafontaine: Das wäre ja, wenn Sie so wollen, etwas Ähnliches gewesen, die Reisefreiheit. Denn das war ja ein ganz wichtiges Thema und deshalb habe ich es immer wieder vorgebracht in meinen Gesprächen mit der DDR-Führung, weil dagegen schwer zu argumentieren war. Wer also – und das war ja so – mir gegenüber vertreten hat, dass der eigene Staat auch von den eigenen Bürgern getragen werde, der konnte schlecht argumentieren, warum er die eigenen Bürger nicht frei reisen lassen konnte. Und das war eben ein Thema, das ich besonders gerne und immer wieder angesprochen habe, weil es logisch zwingend war. Ob es möglich gewesen wäre, diesen Durchbruch zu erreichen, ist heute natürlich reine Spekulation, aber es war ein wichtiges Thema.
Hanselmann: Diese Konstruktion, die da in den letzten Tagen in der Presse natürlich etwas plakativ beschrieben wurde, Sie als Bundeskanzler, Honecker als DDR-Staatsratsvorsitzender in zwei deutschen Staaten, die eng miteinander verflochten sind: Hätten Sie das damals für denkbar gehalten?
Lafontaine: Das kann man heute natürlich nicht sagen, wie weit die Verflechtung wirklich gegangen wäre. Das einzige Besondere bei einer solchen Konstellation wäre gewesen, dass von vornherein ein besseres, wenn man so will, Verständnis vorhanden gewesen wäre, weil wir nun beide aus demselben sozialen Umfeld kommen, dem sozialen und kulturellen Umfeld einer Grenzregion wie das Saarland hier ist, das geprägt war von der Industriekultur. Aber darüber hinausgehend zu spekulieren, das halte ich dann doch nicht für angemessen.
Jeder wäre ja eingebunden gewesen in die politischen Rahmenbedingungen, unter denen zu operieren gewesen wäre. Aber es ist nun einmal so in der Politik, wenn das menschliche Verständnis einigermaßen ist, dann lässt sich natürlich auch Schwierigeres leichter behandeln.
Hanselmann: So wie Historiker Martin Sabrow sagt, dass Ihr gemeinsamer spezieller Saarpatriotismus und Ihre grundsätzlich ähnlichen sozialistischen Vorstellungen eine solche Kooperation hätten möglich machen können?
Lafontaine: Ja nun, mit den grundsätzlich ähnlichen sozialistischen Vorstellungen, das ist natürlich so eine Sache. Ich habe in den Gesprächen mit der DDR-Führung wahrscheinlich offener gesprochen, was diesen Punkt angeht, als viele meiner Kollegen Ministerpräsidenten oder Politiker, die damals mit der DDR-Führung Kontakt hatten, wahrscheinlich auch, weil sie sich mit dieser Frage nie auseinandergesetzt haben.
Ich habe beispielsweise wörtlich immer gesagt, dass ein Mehrparteiensystem vorteilhafter ist und eine wirtschaftliche Ordnung, wie wir sie haben, als die der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist ja unmittelbar einsehbar, wenn man sich vorstelle, wer von der SED ausgeschlossen sei oder nicht mehr akzeptiert werde, habe in diesem Staat keine Chance mehr. Aber wer in der Bundesrepublik beispielsweise bei Mercedes in Ungnade fiel, der könnte ja immer noch zu BMW gehen, und wenn er dort in Ungnade fiel, dann könnte er immer noch zu VW gehen.
Das heißt, ich habe die Pluralität der Machtverteilung in den Vordergrund meiner politischen Vorstellungen gestellt, und dies stieß sicherlich nicht unbedingt auf offene Ohren in der damaligen DDR-Führung. Aber es war einfach notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Sozialismus für mich und für viele, die im Westen über Sozialismus sprachen, nichts anderes war als bis zum Ende gedachte Demokratie.
Hanselmann: Sie mussten sich damals auch von eigenen Parteigenossen, auch prominenten, vorwerfen lassen, Sie wollten die staatliche Einheit verhindern und hätten kein eigenes Konzept für den Einigungsprozess gehabt. Wie sehen Sie das jetzt, über 20 Jahre später?
Lafontaine: Ja, das ist ein ganz normaler Vorgang in innerparteilichen Auseinandersetzungen. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, solche Tabus wie die Staatsbürgerschaft anzusprechen, führte natürlich in der damaligen Zeit zu neurotischen Reaktionen in der SPD-Führung. Den eigentlichen Kontext unter der Bedingung, dass Reisefreiheit gewährt wurde, hat man gar nicht mehr gesehen und vielleicht auch gar nicht die Bedeutung erkannt.
Hanselmann: Es war ja letztlich die Bevölkerung der DDR beziehungsweise die Bewegung "Wir sind das Volk", die den Wandel 1989 beschleunigte und die Wende herbeiführte. Haben Sie in dieser Geschwindigkeit und in dieser Wucht damit gerechnet?
Lafontaine: Nein. Ich habe wie viele andere nicht geglaubt, dass Moskau die DDR aus ihrem Einflussbereich entlassen würde. Das war ja, wenn man so will, das große historische Verdienst Gorbatschows. Und ich habe das auch nicht rechtzeitig erkannt, das muss ich sagen. Aber als dann die Parole "Wir sind das Volk" gerufen wurde, dann war das ja genau das, was dem Sozialismus fehlte oder dem DDR-Sozialismus fehlte. Es ist nun einmal so: Sozialismus ist zu Ende gedachte Demokratie und der Ruf "Wir sind das Volk" war, wenn man so will, eine sozialistische Parole, die eben bei den Vertretern des Staatssozialismus wohl zu lange auf taube Ohren gestoßen ist.
Hanselmann: Sollte diese Parole heutzutage öfter wieder gerufen werden?
Lafontaine: Ja, selbstverständlich. Denn wir sind ja noch lange nicht in einer demokratischen Gesellschaft angekommen. Denn Demokratie ist nach Perikles eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und insofern haben wir allen Grund, unsere Gesellschaften kritisch zu hinterfragen und uns nicht darauf auszuruhen, wenn man so will, mit Zufriedenheit festzustellen, dass der Staatssozialismus eine verfehlte Gesellschaftsordnung war.
Demokratie heißt eben, die Interessen der Mehrheit setzen sich durch. Und wenn Löhne fallen, Renten sinken und soziale Leistungen gekürzt werden, kann ja nur noch jemand, der denkunfähig ist, behaupten, dass sei eine demokratische Gesellschaft!
Hanselmann: Herr Lafontaine, ganz, ganz herzlichen Dank!
Lafontaine: Gern geschehen!
Hanselmann: Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, Oskar Lafontaine, Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl 1990, Ex-SPD-Chef, ehemaliger, langjähriger Ministerpräsident des Saarlandes und jetzt Oppositionsführer für die Linke eben dort.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Geschichte aktuell: Grenzüberschreitungen
Vor 25 Jahren: Das SED-SPD-Ideologiepapier (DLF)
"Bis zuletzt uneinsichtig"
Zum 100. Geburtstag von Erich Honecker (DLF)