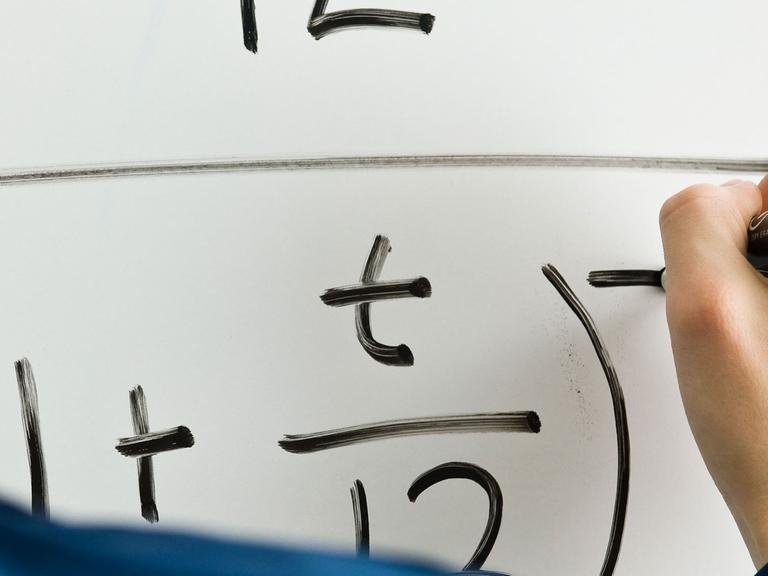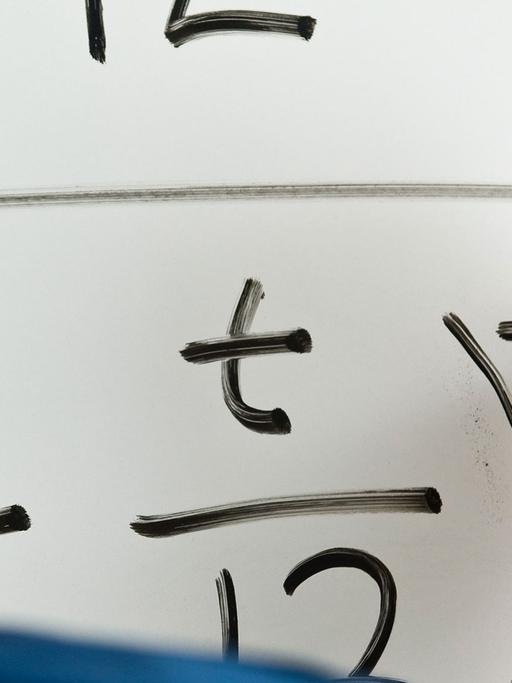Magische Quadrate und Knotenmuster

Von Andrea Westhoff · 29.10.2015
Kerben oder Knotenschnüre statt Zahlen: Bereits seit 100 Jahren beschäftigen sich Mathematikhistoriker und Anthropologen damit, die Mathematik verschiedener Kulturen und Völker zu verstehen - oder sie überhaupt als solche zu identifizieren.
Als der belgische Archäologe Jean de Heinzelin in den 1950er-Jahren seine Ausgrabungen im Kongo in der Nähe des Dorfes Ishango begann, erwartete er nichts Großes. Und als er einen etwa zehn Zentimeter großen versteinerten Pavianknochen mit Einkerbungen fand, war das auch noch keine Sensation. Ein Fund von beachtlichem Alter immerhin – mindestens 22 bis 25.000 Jahre, aber ein "Zählknochen" offenbar, wie man sie auch anderswo schon ausgegraben hatte.
Doch dann beschäftigten sich Mathematiker mit dem Ishango-Knochen und entdeckten, dass die Einkerbungen darauf in drei Reihen angebracht sind, unterschiedlich lang und zu verschiedenen Mengen gruppiert – eine "Statistik", eine Art Rechenspiel oder ein Kalender?
Daran wird immer noch geforscht, aber eines ist klar: Es ist ein Stück Mathematik, das bislang älteste der Welt, gefunden in Afrika.
"Der Mensch ist die einzige Spezies, die den Kampf ums Überleben auch mit theoretischen Mitteln führt. Diese sind in hohem Maße orts- und kulturabhängig."
Ubiratan D’Ambrosio, der "Vater der Ethnomathematik".
"Das ist eine große Triebfeder für viel viel Beschäftigung mit der Mathematik gewesen, dass man damit Probleme lösen kann, die die Gesellschaft natürlich lösen muss."
Wolfgang König, Professor für angewandte Mathematik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Und der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler:
"Es gibt keine Mathematik, es gibt nur Mathematiken."
Jahrhundertelang galt Mathematik als das Symbol der Objektivität, als universell und damit kulturunabhängig. Inzwischen ist so etwas wie Ethnomathematik durchaus denkbar, sagt der Mathematiker Professor Jochen Brüning, Geschäftsführender Direktor des Hermann-von-Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik in Berlin:
"Wenn ich es für mich selbst definieren sollte, dann würde ich sagen: Die Ethnomathematik ist Mathematik, die in irgendeiner Weise, auf irgendeiner Ebene spezifisch ist für das Volk oder den Stamm oder die Kultur, die sie hervorbringt. Wenn Sie Ethnomathematik in Anführungszeichen setzen, bezeichnet das ein gewisses Gebiet von Publikationen, bei denen es darum geht zu erklären, dass die oder die Entdeckung von dem oder jenem Volk zuerst gemacht wurde und alles viel besser und klüger war als bei anderen. Daran möchte ich mich eigentlich nicht beteiligen."
Diese – zugegeben etwas polemische – Definition trifft den Kern des Problems: Es geht um Konkurrenz. Denn historisch ist die Ethnomathematik Teil einer politischen Bewegung, sagt Susanne Prediger, Mathematikprofessorin an der TU Dortmund. "Die Ethnomathematik ist entstanden in den Ländern, wo im Zuge der Entkolonialisierung sich die Völker überlegt haben, in welchen Bereichen sie eigentlich alles dominiert wurden und was es an Alternativen gibt." Sie entstand als eigene akademische Teildisziplin Ende der 1970er, maßgeblich geprägt durch den Brasilianer Ubiratan D’Ambrosio, Professor für Mathematik an der Universität Campinas in São Paulo. Weitere prominente Vertreter der Ethnomathematik haben sich mit der Knotenschnur-Mathematik der Inka befasst. Besonders wichtig für die Erforschung der afrikanischen Mathematik: der Niederländer Paulus Gerdes, langjähriger Rektor der Pädagogischen Universität von Maputo in Mosambik. Er war überzeugt: "Obwohl vermutlich die meisten mathematischen Errungenschaften der ehemals kolonialen Völker verloren gegangen sind, kann mathematisches Denken, das in sehr alten Techniken, wie zum Beispiel Flechtarbeit ’verborgen’ oder 'eingefroren’ liegt, 'aufgetaut' werden." Am bekanntesten sind seine Untersuchungen zur "Sona-Geometrie" der Tchokwe, ein Stamm der Bantu-Kultur, der vor allem in Angola, Sambia und Zaire lebt. Mathematik entsteht erst mit größeren Warenmengen
Ethnologen berichten schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts über die Sandzeichnungen der Tchokwe, die Sona: Wenn die Männer auf dem Dorfplatz oder bei ihren Jagdlagern sitzen, machen Geschichten die Runde, vor allem, um das Stammeswissen weiterzugeben. Dazu zeichnen die Erzähler "eigenartige Flechtmuster, die sich um rote Farbpunkte beziehungsweise in den Sand gedrückte Löcher ranken." Für Paulus Gerdes handelt es sich aber nicht um afrikanische Folklore, sondern um Mathematik: Die Sona entstehen mithilfe eines Koordinatensystems aus Punkten. Darin werden die Linien nicht zufällig gemalt, sondern nach tradierten, strengen Algorithmen, in einem Zug, "monolinear", und schnell, denn jedes Zögern würde von den Zuhörern als Mangel an Wissen gedeutet. In einzelnen hoch komplexen Mustern zeigen sich geometrische Formen und Symmetrien, die die Alltags- und Welterfahrungen der Tchokwe symbolisieren. "Ich finde das absolut faszinierend zu sehen, wenn man erstmal hinguckt, jenseits der dominanten westlichen Kultur, was auch die Kulturen, die schon da waren, an Mathematik hervorgebracht haben. Wir haben daraus auch innerhalb unserer westlichen dominanten Kultur hier viel gelernt: Weil nämlich durch diese Gegenentwürfe, wie man noch auf diese Dinge gucken kann, wir viel sensibler dafür geworden sind, dass es Alternativen gibt." Aber was bedeuten diese "Alternativen", die die Ethnomathematik entdeckt hat? Stellen sie die Einzigartigkeit der Mathematik infrage? Ist sie ein an die jeweilige Kultur gebundenes Produkt oder doch universell? "Die kann man nur mit einem deutlichen sowohl als auch beantworten: Am einfachsten zu verstehen ist das Zählen, die einfache Arithmetik und die elementare Geometrie von Geraden, Dreiecken und Kreisen. Das sind Strukturen, die im Grunde genommen jede hinreichend entwickelte Kultur erfindet, aber jeweils in einem anderen Kontext. Der universelle Bestandteil liegt einfach darin, dass die Mathematik die Kausalität, die unsere Lebenserfahrung ausmacht, in eine abstrakte Form übersetzt." In der Tat haben schon vor mehr als 100 Jahren Mathematikhistoriker und Anthropologen erforscht, wie Menschen verschiedener Kulturen zählen und rechnen, um sich in der Welt zurecht zu finden und Alltagsprobleme zu lösen, zum Beispiel ökonomische: "Ich muss einfach unterscheiden, ob ich zwei, drei oder sehr viele habe, nicht jede Kultur hat Zahlwörter, die über zehn hinaus gehen, die kommen damit aber gut zurecht, weil zählen eben so getan werden kann, dass es einer alleine macht. Indem man, z.B., die Schafherde, die aus dem Gebirge zurückkommt, durch ein kleines Tor treibt und für jedes Schaf ein Steinchen in einen Korb wirft. Dann weiß man, wenn man die Steinchen vom letzten Mal, vom Auszug, aufgehoben hat, kann man vergleichen, ob es mehr oder weniger sind. Dazu muss ich keinen Zahlbegriff haben." Mathematik, so Jochen Brüning, entsteht erst, wenn Kulturen über größere Warenmengen verfügen oder für mehr Menschen Probleme bewältigen müssen. "Sagen wir in Mesopotamien wurden die Menge des Getreides und der Schlüssel der Verteilung auf den berühmten Tontafeln festgelegt, und die kamen an einen zentralen Ort, das setzt voraus, dass alle die, die das machen, auch denselben Code schreiben. Was ja einfach heißen soll, ich hab ein System von Symbolen, das sind z.B. die Einprägungen, die dieser Griffel des Schreibers einer Tontafel machen kann, eine bestimmte Ausdrucksform für Sachverhalte, die auch jede andere Kultur erkennen würde, aber sie würde sie anders ausdrücken. Beispielsweise weil man verschiedene Sprachen hat, es wäre aber ganz leicht, das miteinander zu vergleichen, indem man sagt: ‚Das hier bedeutet das, und das hier bedeutet das, und das sind fünf und das sind zehn’, und das wiederum enthüllt einen universellen Charakter." Mit diesem universalistischen Konzept der traditionellen "Geschichte der Mathematik" geht aber nicht nur die Vorstellung einher, dass die mathematischen Fähigkeiten zur Abstraktion in verschiedenen Kulturen unterschiedlich entwickelt sind. Das behauptet jedenfalls der brasilianische Ethnomathematiker Ubiratan D’Ambrosio: "Nach traditioneller europäischer Auffassung ist die Geschichte der Mathematik eine geradlinige Entwicklung von einem primitiven Urzustand bis zur gegenwärtigen Hochblüte. Demnach wäre alles, was sich fern von diesem Hauptstrom abgespielt hat, eine verfehlte Bemühung, ein nettes Kuriosum oder bestenfalls ‚richtige’ Mathematik in exotischem Gewand. Es ist an der Zeit, diese einseitige, kolonialistische Sicht abzulegen." Kerben statt Zahlen bei amerikanischen Ureinwohnern Dass einfachstes Zählen und abstraktes mathematisches Denken nebeneinander in einer Kultur existieren können, zeigt sich am Beispiel der Ute. US-amerikanische Ethnomathematiker haben dieses Volk amerikanischer Ureinwohner untersucht, deren Stammesgebiet im heutigen US-Bundesstaat Utah liegt. "Die Ute hatten praktisch keine Zahlenbegriffe. Sie machten Kerben, um Mengen festzuhalten und nutzten zum Zählen im Alltag die Umgangssprache: 'ein paar – es geht immer und immer weiter – davon gibt es nichts mehr'. Oder sie verwendeten natürliche Maße: 'eine Handvoll – drei Tagesritte – wenn die Sonne zweimal aufgegangen ist'. Und gerechnet wurde oft nach sozialen statt nach mathematischen Regeln: Wenn beispielsweisezwei Leute den 'gleichen Anteil' der Jagdbeute bekamen, konnten die Portionen sehr unterschiedlich groß sein. Jeder erhielt so viel, wie seine Familie brauchte oder es dem sozialen Rang entsprach." Aber die Ute sind auch berühmt für ihre Stickereien: vor allem lange, schmale Borten aus Dreiecken, Kreisen, Kreuzen und Rechtecken. Und hierbei gab es ganz feste – mathematische – Regeln: Die geometrischen Muster sind identisch groß, symmetrisch angeordnet, vielfältig gespiegelt und nach einem festen Zahlenschema gruppiert. Sie dienten der Überlieferung von Traditionen und Geschichten, die exakt sein musste. Oder sie stellten Stammeswerte und Gefühle dar, die nicht beliebig verändert werden durften. Die Ethnomathematik vertritt einen nicht-historischen, anthropologischen Ansatz: Alle Kulturen haben aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebenserfahrung eigene mathematische Denkweisen entwickelt, sagt Ubiratan D’Ambrosio: "Menschengruppen, die in Wäldern lebten, haben andere Methoden der Landvermessung und damit andere Geo-Metrien – im wörtlichen Sinn von Erdmessungen – entwickelt als Steppenbewohner. Je nach Region unterschieden sich auch die Kalender und damit die Mittel der Produktion, der Kontrolle und der Verteilung, die Organisation der Arbeit, das städtische Leben und zahllose andere Bräuche." Die Idee, dass jede Kultur ihre spezielle Mathematik hat, ist eigentlich schon älter als die Ethnomathematik. So schreibt Oswald Spengler 1918 in seinem Werk "Der Untergang des Abendlandes": "Wir finden einen indischen, arabischen, antiken, abendländischen Typus des mathematischen Denkens, jeder von Grund aus etwas Eignes und Einziges, jeder Ausdruck eines andern Weltgefühls (…) Es gibt demnach mehr als eine Mathematik." "Man fragt sich natürlich: Wo sage ich, dass eine Mathematik anders ist als eine andere Mathematik?" ... sagt Wolfgang König, Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie an der TU Berlin. "Also ich würde sagen, es hat sich ein gewisser Standard an den weltweiten Universitäten durchgesetzt, der sicher sehr stark fußt auf der Mathematik, die im Laufe der letzten 500 Jahre vielleicht in Europa entwickelt worden ist. Wenn ich zu irgendeiner Universität in der Welt fahre, sei es Südafrika oder Peru oder in Novosibirsk, dann erwarte ich immer einen gewissen Standard, dass ich mit den Leuten dort reden kann darüber. Eine andere Frage ist natürlich, ob die dortigen lokalen Leute vielleicht ganz andere Themen der Mathematik sich vorgenommen haben, so dass ich aus diesem Grunde mit ihnen nicht mehr reden kann. Kann man das dann eine andere Mathematik nennen? Da bin ich nicht ganz sicher." Ein gern gewähltes Beispiel der "Universalisten" gegen die Ethnomathematik: "Die Winkelsumme im ebenen Dreieck ist 180 Grad, einerlei ob man im Urwald oder in einer Stadt mit lauter rechtwinkligen Wänden aufgewachsen ist." Dazu die Dortmunder Mathematikdidaktikerin Susanne Prediger: "Die Frage ist ja, was bedeutet denn dieser Satz eigentlich? Und der bedeutete im Laufe der Geschichte etwas völlig unterschiedliches. Ist das ein Statement, was wir rauskriegen, indem wirs einfach nachmessen? Ist das ein Statement, was wir einbinden in ein Theorienetz? Oder befinden wir uns sogar in Zusammenhängen, wo es gar nicht gilt? Sobald Sie zum Beispiel ein Dreieck auf eine Orangenschale malen und dann nachmessen, wie die Winkelsummen sind, stimmt das gar nicht mehr." Weg von universellen, mathematischen Wahrheiten Der Gedanke der Universalität bekam tatsächlich einige Dämpfer in den letzten gut 100 Jahren: zum Beispiel durch die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie. Sie führte dazu, dass manche geometrischen Gesetze der antiken Mathematik angesichts der Krümmung der Erdoberfläche nicht absolut gelten. "Wahrscheinlich ist die Mathematik eines der Fächer, was am universellsten ist, wo das schon mit am besten gelingt, sich quer über die Welt zu verständigen, das ist wahr. Trotzdem hat das auch da seine Grenzen." Aber Ethnomathematik will gar keine fundamentale Diskussion um mathematische Wahrheit. Sie verfolgt eher die Idee der „friedlichen Koexistenz der vielen Mathematiken“. Allerdings ist es schon ihr Anliegen, eine neue, "echte Kulturgeschichte der Mathematik" zu begründen. So hat sich der niederländische Mathematiker Paulus Gerdes zum Beispiel immer wieder darum bemüht, den Anteil afrikanischer Mathematiker an der Geschichte stärker ins Bewusstsein zu rücken. Zuletzt 2013 auf einer Bildungs-Konferenz für Südafrika: "Wenn Sie Ihr Handy anschauen, sehen Sie Symbole wie 'plus', 'gleich', ein Wurzelzeichen oder Brüche. Und, was Sie vermutlich nicht wissen: Das erste Mal in der Geschichte wurden solche mathematischen Symbole, Abkürzungen, abstrakte Bezeichnungen in Afrika erfunden! Im 12. Jahrhundert! Im Nordwesten Afrikas, im Maghreb." Das entsprechende Manuskript aus dem 12. Jahrhundert wurde 1998 gefunden. Es ist in arabischer Sprache verfasst, aber der Autor, Ibn al-Yasamin, war kein arabischer Mathematiker. Der Name bedeutet wörtlich "Sohn der Jasmin-Blume", und das zeigt, dass seine Mutter eine schwarzen Sklavin war, die nach Nordafrika verkauft wurde, erzählt Gerdes: "Sie benutzen heute Ihren Taschenrechner oder Ihr Handy, und einige der wichtigsten Ideen dahinter wurden entwickelt von einem schwarzen afrikanischen Mathematiker." Zu der ethnomathematischen "echten Kulturgeschichte der Mathematik" gehört natürlich auch die Erforschung und die Wieder- oder Neu-Entdeckung der Mathematik Südamerikas. Das sind zum einen die komplexen Kalenderberechnungen der Maya, vor allem aber die Mathematik der Inka in den Knotenschnüren, den Quipus. Etwa seit dem 13. Jahrhundert hatten die Inka ein riesiges Reich errichtet, das sich vom heutigen Nordchile bis Kolumbien erstreckte und seine Blütezeit im 15. Jahrhundert erlebte: mit großen Städten, imposanten Bauwerken, einer florierenden Wirtschaft mit einer straffen Zentralverwaltung von der Hauptstadt Cuzco aus und einem schlagkräftigen Militär. Dafür war viel Mathematik nötig, die in den Quipus verborgen ist. Sie bestehen jeweils aus einer Hauptschnur, an die unterschiedlich lange Nebenschnüre geknotet sind, dicht nebeneinander wie ein Fransen-Vorhang, erzählt Gary Urton, Professor für Pre-Columbianische Studien und Direktor des Fachbereichs Anthropologie an der Harvard University, bei einem Vortrag im November 2013. "Wir haben einige Quipus mit 1500 Schnüren. Die sind so riesig, dass zwei Menschen nebeneinander stehen müssen, um sie mit ihren Händen aufzuspannen. Und wir haben Exemplare mit sechs Hierarchien von Nebenschnüren gefunden. Das war also eine ähnlich hierarchische Ordnung, wie wir sie bei der Sozial- und Organisationsstruktur des Inkareiches gesehen haben." In die Nebenschnüre wurden die Zahlen geknotet, nach einem Stellenwertsystem auf der Basis 10 zur Hauptschnur aufsteigend: also unten die Einer, dann die Zehner, oben die Hunderter. Für die Tausender, Zehntausender und so weiter gab es wieder anderen Knotenarten. Auch die Null kannten die Inka offenbar, wie die deutlichen Zwischenräume auf den Schnüren zeigen. Kolonialismus im Mathematikunterricht Die meisten Quipus wurden als heidnische Symbole von den spanischen Eroberern im 16. Jahrhundert verbrannt, aber glücklicherweise gibt es noch ein paar hundert in Museen. So konnte die Zahlencodierung inzwischen entschlüsselt werden. Dennoch bleiben viele Rätsel: "Nun können wir also die Zahlen auf den Quipus lesen, aber unser großes Problem und damit die Herausforderung der Forschung ist: Wenn man sagen kann, 'diese Schnur zeigt die Zahl 602', dann bleibt die Frage: '602-was?'" Klar ist, dass auch die Farben, die Art der Fasern und der Knüpfung der Knotenschnüre Informationen enthalten. Und da die Inka keine Schrift hatten, nimmt man an, dass sich in den Quipus noch viel mehr verbirgt als Mathematik. Ziel der ethnomathematischen Forschungen ist aber nicht nur eine Neuorientierung der Mathematik-Geschichte. Der brasilianische Mathematiker Ubiratan D’Ambrosio von der Universität Campinas in São Paulo weist darauf hin, dass in der so genannten Dritten Welt die Nachwirkung des Kolonialismus gerade in der Mathematikdidaktik noch lange zu spüren waren: Seit den 1960er Jahren wurden den entkolonialisierten Ländern oft Lehrpläne für die Schulen erstellt, die sich besonders strikt an den europäischen mathematischen Traditionen orientierten. Professor Jochen Brüning, Mathematiker und Direktor des Hermann-von-Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik in Berlin, findet diese Kritik eher abwegig: "Dass die Kolonialmächte nun in ihren Schulen den Unterricht gemacht haben, den sie auch zuhause gemacht haben, ist sicherlich nicht als Ausbeutung gedacht gewesen, sondern es ging darum, das Wissen, über das sie verfügen, weiterzugeben." Der Ansatz eines einheitlichen Mathematikunterricht sei jedenfalls vernünftig ... "... wenn der auch vielleicht nicht immer auf fruchtbaren Boden fiel, einfach deshalb, weil diese Gegenstände nicht so beigebracht wurden, wie die in den natürlichen Sprachen der Gegend vielleicht dargestellt worden wären, es ändert aber nichts daran, dass an der Richtigkeit und der Notwendigkeit der Mathematik universell heute in keiner Weise mehr gezweifelt wird." Für Susanne Prediger, Professorin für Mathematikdidaktik an der TU Dortmund, ist die Rolle des Kolonialismus auf der schulischen Ebene nicht ganz so eindeutig: "Das ist ja wirklich auch eine ganz schwierige Frage. Also tun wir den Schülerinnen und Schülern in Afrika was Schlechtes, wenn wir ihnen westliche Mathematik beibringen oder tun wir ihnen was Gutes? Wir tun ihnen was Gutes in dem Sinne, als sie Zugang bekommen zu der dominanten Mehrheitskultur, und das ist auch wichtig. Wir haben damit aber auch viel Schlechtes getan, weil wir einfach zu wenig anknüpfen an das, was die Schülerinnen und Schüler als Ressourcen mitbringen und auch zu wenig wertschätzen, was an Alternativen da wäre." Auf den Prinzipien der Ethnomathematik basierend wurden in den 1970er und 80er Jahren in den Entwicklungsländern eigene didaktische Konzepte entwickelt. Dass das funktioniert, haben Studien gezeigt: "Zum Beispiel eine der meist zitierten Untersuchungen, stammt auch aus Brasilien, hat untersucht, wie unglaublich flexibel und fit Straßenkinder sein können, wenn sie mit Geld umgehen müssen beim Verkaufen von Bonbons. Die können alles: Vorwärts, rückwärts, mit großen Zahlen, wenn die aber im Unterricht sitzen, geht’s plötzlich nicht mehr. Diese Kinder haben überhaupt keine Beziehung hergestellt zwischen ihrem flexiblen Umgang mit Geld und dem Bestimmen von Rückgeld, und den formalen Aufgaben, die sie in der Schule gekriegt haben. Das ist so eine Untersuchung, die hat uns total aufgerüttelt vor 20 Jahren, weil wir gemerkt haben: Viele Kinder haben eine Menge Ressourcen, die wir in der Schule nicht nutzen, egal, wo die herkommen." Für Susanne Prediger war die Ethnomathematik eine gute Anregung und Vorlage für ein generelles Umdenken in der Didaktik: "Das sind ja nicht nur die Eingeborenen irgendwo, die zunächst mal einen anderen Zugang zu den Dingen haben, sondern: Jedes Kind, auch hier, mitten in der Stadt, kommt mit sehr eigenwilligen Ideen in die Schule. Und wo wir früher gesagt haben: „Das ist falsch!“, sagt die Didaktik ja eigentlich seit einigen Jahren, wir müssen das, was die Kinder da mitbringen, auch in gewisser Weise würdigen und damit umgehen, weil nur, wenn wir da eine Verbindung herstellen zu dem, was die auch lernen sollen, wird dieser Lernprozess erfolgreich sein." Und das gilt auch für den Mathematikunterricht: "Matheunterricht hat sich deutlich verändert vom tumben Rechnen mit den eindeutigen Lösungen hin zum Diskutieren von Ideen und Lösungswegen und Alternativen, noch nicht alle Lehrer machen mit, aber es passiert ganz viel und das ist auch gut." "Mit der Vielfalt rechnen“, nennen Susanne Prediger und einige Kollegen dieses Konzept zum interkulturellen Mathematikunterricht, das auch mit ethnomathematischen Beispielen arbeitet: Magische Quadrate als Lehrhilfsmittel Magische Quadrate etwa lassen sich in der Schule sehr gut nutzen: diese mit Zahlen gefüllten Vierecke, in denen mindestens die Summe in jeder Zeile, in jeder Spalte und jeder Diagonale gleich sein muss. Es sind noch viel mehr erstaunliche Varianten möglich. Sie tauchten in Europa erstmals im 14. Jahrhundert auf, gehören aber vor allem zur arabischen Mathematik-Kultur des 10. bis 12. Jahrhundert. In diesem goldene Zeitalter der "Rechenkunst", im wahrsten Sinne des Wortes, waren in der muslimischen Welt neue Gesellschaftsschichten entstanden – Lehrer, Beamte und Höflinge. Und für die schuf man eine neue Form der Kultur: popularisierte Versionen des gelehrten Wissens, mathematische Gedichte vor allem, oder Gesellschaftsspiele mit wissenschaftlichem Charakter, eben die magischen Quadrate. Kann aber auch direkt bei den unterschiedlichen Kulturen der Kinder ansetzen: "Zum Beispiel: Im Türkischen heißt ´ein Viertel` nicht ´ein Viertel` – wenn wir ´ein Viertel` sagen, dann sagen wir ja im Grunde genommen ´eins von dem vierten Teil`. Im Türkischen ´dörte bir` heißt ´vier, darin eins`. Indem wir uns mit den türkischen Kindern mal darüber unterhalten, wie die so einen Bruch aussprechen, können auch einige deutsche Kinder sagen, ´oh, das ist eigentlich viel besser, damit verstehe ich viel besser, was so ein Bruch bedeutet.` Und wir haben zwei Perspektiven auf das mathematische Objekt, die sich wunderbar ergänzen können. Das sind so Stellen, wo wir auch super zurückgreifen können auf die anderen Erfahrungen, die da in der Klasse sitzen." Dieses Ansetzen beim kulturellen Hintergrund der Kinder wurde allerdings schon in den Anfangszeiten der Ethnomathematik in den entkolonialisierten Ländern selbst problematisiert: Was, wenn mehrere Kulturen in der Schule zusammenkommen? Aus Sicht von Professor Jochen Brüning ein Argument für die "universelle Mathematik": "Wenn sie innerhalb einer Kultur aufwachsen, dann werden sie, wenn sie abstrakte Gegenstände behandeln müssen, natürlich Kontextualisierungen aus der Kultur, die vor ihren Augen liegt oder in ihrem Kinderzimmer, auch wählen. Das ist sicherlich sinnvoll. Wenn man natürlich verschiedene Kulturen mischt in der Schule, dann ist es sicherlich besser, ein gemeinsames Tool einzuführen, ein gemeinsames Zeichensystem, was den Kindern auch gemeinsam verständlich gemacht werden kann." "Das sagen forschende Mathematiker gerne, dass ja die Mathematik so schön sprachübergreifend ist und man sich so toll verständigen kann. Das gilt leider nur für die, die schon alles verstanden haben. Wenn ich in der Sprache, in der ich die Mathematik lernen soll, nicht richtig denken kann, dann entsteht ein erhebliches Problem, und das lässt sich empirisch auch zeigen." Ohne Frage gibt es heute die Mathematik, die unser Leben bestimmt. Aber in weiten Teilen gilt immer noch das „kulturelle Paradox“, das Hans Magnus Enzensberger schon 1998 beschrieben hat, in einem Essay anlässlich des Weltkongresses der Mathematiker in Berlin: "Noch nie hat es eine Zivilisation gegeben, die bis in den Alltag hinein derart von mathematischen Methoden durchdrungen und derart von ihnen abhängig war wie die unsrige, das allerdings in einer Kultur, die sich durch ein profundes mathematisches Nichtwissen auszeichnet." Der Titel des Essays lautete "Die Mathematik im Jenseits der Kultur". Vielleicht kann ja die Ethnomathematik sie wieder stärker ins kulturelle Bewusstsein rücken und gleichzeitig für mehr mathematische Bildung sorgen. Oder wie es der Ethnomathematiker Paulus Gerdes formulierte: "Alle Völker sind imstande, Mathematik zu entwickeln. Dieses Vertrauen wird die Aneignung der ´Welt-Mathematik` vereinfachen." Wer in den südindischen Bundesstaat Tamil Nadu reist, kann sie manchmal heute noch sehen: die Kolams - komplexe geometrische Muster, die junge Frauen am frühen Morgen vor die Türschwellen ihrer Häuser malen. Freihändig lassen sie Reismehl oder farbiges Steinpulver zwischen den Fingern hindurchrieseln und orientieren sich dabei an einem Punktegitter, das sie zuvor auf den feuchten Boden gedrückt haben. Diese Kolams wurden Anfang der 2000er Jahre von Informatikern analysiert, und die amerikanische Ethnomathematikerin Marcia Ascher schrieb dazu: "Damit hat eine reiche und hoch geschätzte kulturelle Tradition nun auch akademische Weihen erhalten." Aber, so Ascher weiter, auch die Informatiker profitierten: "Für einen Wissenschaftler ist es doch Beweis für die Sinnhaftigkeit seines Tuns, wenn er diese Strukturen in der Realität, weitab von den Wurzeln seiner eigenen Wissenschaft, vorfindet." Weiterführende Hinweise zu ethnomathematischen Forschungen:Ubiratan D’Ambrosio: "In 80 Mathematiken um die Welt", in: Spektrum der Wissenschaft Spezial: "Ethnomathematik", 2/2006, S. 6-9.Paulus Gerdes: Ethnomathematik - dargestellt am Beispiel der Sona Geometrie. Spektrum Akademischer Verlag, 1997Mathematische Forschungen zum Ishango-Knochen von Dirk Huylebrouck, von der Hochschule für Kunst und Wissenschaft in Brüssel Zu den Kolams: Marcia Ascher, emerit. Mathematikprofessorin am Ithaka College, New York, in: Spektrum der Wissenschaft 6/2003,S. 74 (M.A. hat zus. mit dem Anthropologen Robert Ascher Ende der 1970er Jahre zuerst den "Code of the Quipu" erforscht)Zu den Ute: Jim Barta, Professor für Erziehungswissenschaft an der Staatsuniversität von Utah in Logan, Tod Shockey, Professor für Mathe an der Universität von Maine in Orono, Cathy Barkley, Ethno-Mathematikerin, vom Mesa State College in Colorado, in: Spektrum der Wissenschaft Spezial: "Ethnomathematik", 2/2006, S. 60 - 67