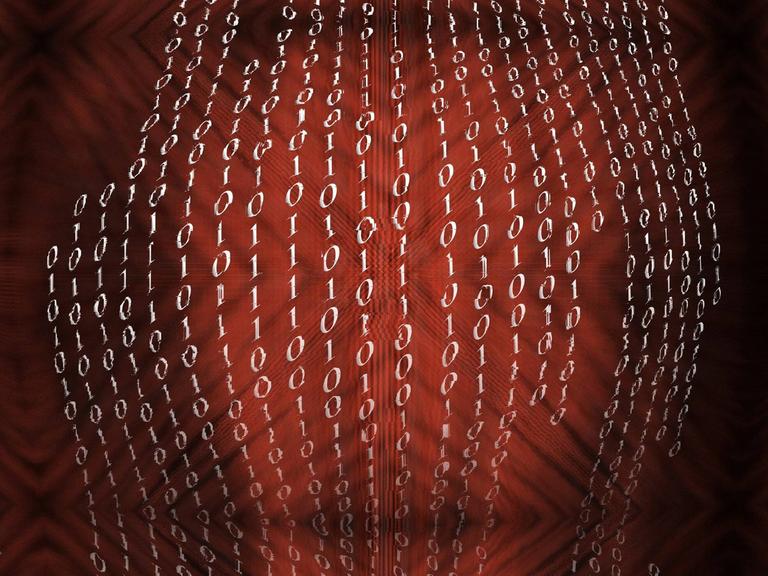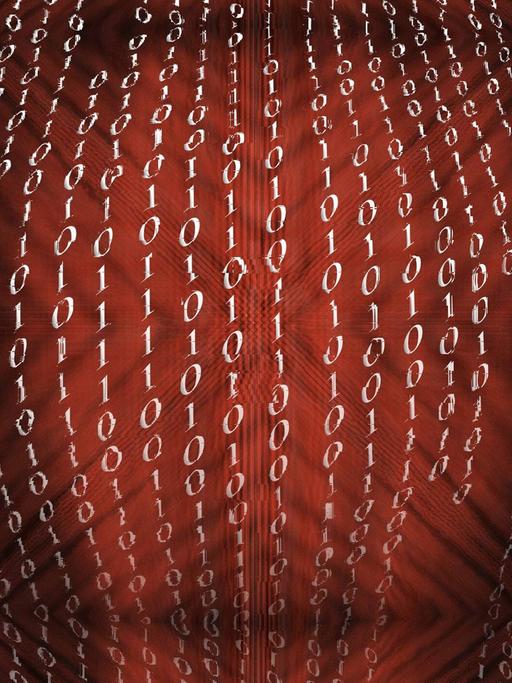Text ist nicht alles

Von Paul Stänner · 17.02.2017
Finden wir die Literatur der Zukunft mit einer klobigen Bildschirmbrille auf der Nase, die uns bewegte Bilder vorspielt, während wir Texte lesen und hören?
Dirk Bertels: "Zum Beispiel, ich seh hier in den ersten paar Zeilen, dass der Rhythmus des Textes gleich ist. Wir sehen hier Cyan-grün-lila und in der zweiten Zeile Cyan-grün-lila und in der dritten Zeile Cyan-grün-lila, da ist also ein gewisser Rhythmus, und ich schau hier in meine Wortliste und sehe: Ach guck!, hier gibt’s in den ersten fünf 5 mal die gleiche Farbe und ich sehe hier unten, da gibt es 5 mal ich und es fängt noch an mit einem Großbuchstaben und ich guck mal, Ach! das passt ja herrlich rein, so, das ist ja ein ganz einfaches Gedicht auf die Art…"
Dirk Bertels wischt mit dem Finger über sein Tablet und puzzelt sich ein Gedicht. Jeder weiß, ein Gedicht besteht aus mehreren Zeilen, jede Zeile aus mehreren Wörtern. Auf dem Tablet von Bertels aber sind die Wörter ersetzt durch farbige Rechtecke. Die jeweilige Farbe signalisiert einen Worttyp: Cyan zum Beispiel soll ein Substantiv sein, grün ein Verb und gelb ein schmückendes Adjektiv. Mit den vielen bunten Rechtecken sieht das Display nun aus wie ein konstruktivistisches Gemälde.
"Ja genau, ein kleiner Mondrian, aber es ist völlig basiert auf dem Gedicht."
Am Fuß des Displays erscheint eine Reihe von Wörtern, die scheinbar wahllos hintereinander gehängt sind. Die Aufgabe für den Puzzle-und-Lyrik-Freund besteht nun darin, ein Wort seiner Wahl in eines der bunten Rechtecke zu ziehen und zu prüfen, ob es an dieser Stelle passt. Wenn es passt, bleibt es, wenn nicht, schickt das System das Wort unerbittlich wieder auf die Fußleiste.
Ist das die Zukunft der Literatur? Als vor einigen Jahren die E-Reader aufkamen, spaltete sich die Gemeinschaft der Lesenden sofort in das Lager der engagierten Display-Befürworter einerseits und wütender Verteidiger des bedruckten Papiers andererseits. Ich wollte wissen, wie sich das Erzählen von Geschichten in der Zukunft gestalten wird. Dafür bin ich umhergereist. Auch nach Amsterdam, zur Niederländischen Stiftung für Literatur.
Dirk Bertels: "Ich habe jetzt 'kratzender' und davon gibt es vier gelbe Orte, wo ich es reinstellen kann, also ich kann es nur auf einen Platz machen."
Poesieproduktion und Computerspiel verbinden sich zu einem Gemeinschaftserlebnis: Statt eines Ballerspiels erscheint auf dem Display Liebeslyrik. Aber nicht ready-to-read − die Leser müssen sich ihr Gedicht wie ein Puzzle erarbeiten.
Die niederländische Literaturszene, gestärkt vor allem durch die reiche Comic-Tradition der flandrischen Belgier, genießt den großen Vorteil, dass ihr Verhältnis zum Erzählen von Geschichten viel spielerischer ist als in unserem Literaturbetrieb.
Dirk Bertels: "Was macht die Poesie zur Poesie? Die Poesie ist natürlich nicht nur Lesen, so wie wir Zeitung lesen oder Literatur lesen, sondern mit Poesie muss man sich auf eine andere Art befassen. Wir haben gewählt: Auf eine gewisse Art tauchen wir in den Kopf des Dichters, und als Spieler muss man das Gedicht rekonstruieren. Und wir geben Hinweise, wie das Gedicht zu rekonstruieren ist."
Ein Gedicht wird zur App
Lucas Hirsch ist Lyriker und Organisator von Literaturveranstaltungen. Er ist der Autor, der die Spieleentwicklung begleitet hat. Zu den Sponsoren der Entwicklung gehören in eigenwilliger Zusammenarbeit die "Niederländische Stiftung für Literatur" und der "Stimuleringsfonds Creatieve Industrie" − damit ist deutlich, hier wird ein neues Feld erschlossen! Und was haben die Dichter davon?
Lucas Hirsch: "Für einen Dichter ist es cool, dass man aus deinem Gedicht ein Spiel macht, eine App, und damit hat er Zugang zu vielen Menschen, wenn sie deine App downloaden. Das ist kostenlos, und so können viel mehr Menschen dein Gedicht lesen, und ich hoffe, dass viele Menschen, nachdem sie das Spiel gespielt haben, sich mehr für Poesie interessieren."
Mein Eindruck: Wenn man ein Gedicht spielerisch rekonstruiert, beschäftigt man sich intensiv und lustvoll mit ihm. Hat man es zwei Mal rekonstruiert, haben sich vermutlich schon einige Zeilen im Kopf festgesetzt. Beim dritten Mal fängt man an, es zu behalten, ohne dass man sich unbedingt vornehmen muss, es auswendig zu lernen.
1892 erschien der Roman "Das tote Brügge" des belgischen Schriftstellers Georges Rodenbach. Er erzählt die ziemlich morbide Geschichte eines trauernden Witwers in Brügge, der versucht, seine verstorbene Gattin in einer anderen Frau wieder zu erschaffen.
Das in seiner Zeit Außergewöhnliche an diesem Roman war, dass in der Buchausgabe 35 Fotografien enthalten waren, jeweils mit unbedruckter Rückseite, so dass sie einen bedeutenden Anteil an diesem nicht sehr langen Roman hatten. Die Fotos zeigen – wie im Titel angekündigt – das tote Brügge: Mächtige düstere Gebäude, weite leere Plätze, hohe Türme an den für Brügge typischen Kanälen, in deren Wasser sie sich eben nicht spiegeln. Text und Bild erschaffen eine beklemmende Atmosphäre.

Der Schriftsteller Thomas von Steinaecker© dpa / picture alliance / Arno Burgi
2012 veröffentlichte der Schriftsteller und Filmemacher Thomas von Steinaecker seinen Roman "Das Jahr, in dem ich aufhörte mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen". Die Geschichte der Versicherungsvermittlerin Renate Meißner setzt am 1.Oktober 2008 ein, in dem Jahr, als die Bankenkrise alle Sicherheiten wegwischte. Der Roman ist durchsetzt mit Fotos, die einer eigenen Logik folgen. Sie kommentieren nicht den umliegenden Text, sondern entwickeln eine eigene Erzähllinie. Der Autor erläutert:
"Auf der Fotoebene wird eine Metaebene zum Text aufgespannt, was aber für viele Leser, glaub ich, eine Schwierigkeit darstellt, weil die erst mal darauf achten, Warum wird jetzt dieses Büro bebildert, was dann eine Seite später so geschildert wird und warum ist am Schluss ein Bild von Schnee? Also die bringen gar nicht die erste mit der letzten Seite in Verbindung."
Und da zeigte sich, dass für die Leserinnen und Leser die Konvention, hier einen Romantext zu haben und dort eine Bilderstrecke, nur sehr schwer zu durchbrechen ist. Jedenfalls war das die Erfahrung von Thomas von Steinaecker:
"Die Reaktionen auf den Roman haben mir immer wieder gezeigt, es gibt komischerweise immer wieder Leute, die scheinen ein Verhältnis zur Fotografie und auch kein Problem zu haben, wenn das in Romanen auftaucht, aber merkwürdigerweise die Mehrheit der Leute, der Leser, ist tatsächlich noch immer irritiert, wenn im Roman Fotos auftauchen, was ja irgendwie im 21. Jahrhundert seltsam ist, weil wir ja in einer Bilderwelt leben."
2015 machte Hans Magnus Enzensberger, wie immer experimentierfreudig, jenseits des Mainstreambetriebs sein eigenes Ding: "Immer das Geld" hieß sein Roman. Die reiche, alte Tante Fé erklärt Nichten und Neffen aus einem mittelständischen Beamtenhaushalt die Finanzströme. Der "kleine Wirtschaftsroman", wie Enzensberger sein Buch nannte, ist von dem früheren Verleger und Enzensberger-Freund Franz Greno überreich mit Fotos, Bildern und Grafiken dekoriert, kaum ein Blatt blieb davon verschont.
Das Verfahren ist faszinierend: Das geschriebene Wort und die optischen Hilfsmittel stehen gleichwertig nebeneinander. Während der Leser den Text aufnimmt, wird dieser von den Bildern zeitgleich kommentiert und interpretiert.
Auch hier wiederholte sich die Steinaeckersche Erfahrung: Die professionellen Rezensenten reagierten spröde. Die "Süddeutsche Zeitung" räumte ein, es sei ein "reich bebilderter Dialog-Roman", die "Welt" fasste die Handlung zusammen, sah aber offenbar überhaupt keine Bilder. Und die "Frankfurter Allgemeine" erwähnte lediglich, dass Enzensberger "die Geschichte mit Fotos und Collagen aller Art inszenieren lässt".
Offenbar ist es so, dass die Ergänzung des Mediums Schrift durch nur ein weiteres Medium, das Bild, bereits Unverständnis auslöst. Dabei ist das Verfahren nicht neu: Die mittelalterliche Liedersammlung Codex Manesse weist auf ihren gut 400 Seiten schon 138 Miniaturmalereien auf.
Mittlerweile ist die Welt ist komplizierter geworden, wohl wahr! Aber die Möglichkeiten auch vielfältiger und bunter! Das Medium Schrift wird nicht allein durch ein weiteres Medium ergänzt, sondern durch alle möglichen.
Was ist ein Essay-Gedicht?
Djakarta, die Hauptstadt Indonesiens. Denny Januar Ali, für die Öffentlichkeit nur Denny J.A., ist eine Medienpersönlichkeit. Er hat in den USA promoviert, war politischer Moderator im indonesischen Fernsehen, und ist als Politik-Berater in den Ruf gekommen, "Königsmacher" bei den indonesischen Präsidentschaftswahlen zu sein.
Denny J.A.s Erfindung ist das Essay-Gedicht, ein Langgedicht, für dessen Verbreitung er viel Geld einsetzt. Dennys Definition für das Essay-Gedicht lautet
A) es behandelt einen gesellschaftlichen Missstand,
B) es ist zum leichteren Lesen in Kapitel unterteilt,
C) es ist in einer einfachen Sprache gehalten und
D) wie in einer wissenschaftlichen Arbeit werden in Fußnoten die Belege aus Zeitungen, Statistiken usw. mitgeliefert, die die Erzählung beglaubigen.
A) es behandelt einen gesellschaftlichen Missstand,
B) es ist zum leichteren Lesen in Kapitel unterteilt,
C) es ist in einer einfachen Sprache gehalten und
D) wie in einer wissenschaftlichen Arbeit werden in Fußnoten die Belege aus Zeitungen, Statistiken usw. mitgeliefert, die die Erzählung beglaubigen.
"Ich bin als politischer Aktivist aufgewachsen. Ich fühle immer noch die Verpflichtung, etwas für mein Land zu tun, die sozialen Verhältnisse in diesem Land zu verändern. Unsere neuesten Umfragen belegen, dass die Diskriminierung immer mehr zunimmt. Ich möchte die Demokratie voranbringen und fühle die Verpflichtung, ein Indonesien ohne Diskriminierung zu schaffen."
Mehrfach gab es in Indonesien Pogrome gegen Minderheiten, zum Beispiel gegen Chinesen. Das Thema ist vermintes Gelände, auf dem man sich nur mit äußerster Sensibilität bewegen kann. Dennys Gedicht "Das Taschentuch der Fang Yin" erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus der chinesischen Bevölkerungs-Minderheit, die während des Pogroms 1998 vom Mob barbarisch vergewaltigt wurde.
"Dann hörte man andere Schreie: 'Verbrennt sie, die Chinesen, zündet sie an!'
Und eine Horde großer, stämmiger Männer / stürmte Geschäfte und Wohngebiete der Chinesen. / Drang in die Häuser der Schlitzaugen ein , packte sie sich, schlug ein auf die Männer / und vergewaltigte die Frauen. Und keiner vermochte die Opfer zu zählen."
Und eine Horde großer, stämmiger Männer / stürmte Geschäfte und Wohngebiete der Chinesen. / Drang in die Häuser der Schlitzaugen ein , packte sie sich, schlug ein auf die Männer / und vergewaltigte die Frauen. Und keiner vermochte die Opfer zu zählen."
Dennys Gedicht über Fang Yin wird in mehreren Medien präsentiert: Zunächst als gedrucktes Gedicht. Dann wurde der Text erweitert zur graphic novel. Aus der graphic novel wurde ein animierter Film. Und es gibt auch eine Straßentheater-Version. Im Film, von dem es auch eine deutsche Fassung gibt, sind die Fußnoten, die die Tatsachen belegen, eingeschnittene Filmaufnahmen aus den indonesischen Fernsehnachrichten. Das Essay-Gedicht endet mit einer zukunftweisenden Botschaft:
"Vor dreizehn Jahren war sie angekommen in Amerika, / trug mit sich Wut und Zorn, / trug mit sich einen tiefen Hass auf das Land, das Indonesien heißt.
Jetzt will sie heim, ist voller Sehnsucht, und sie hofft,
dass Indonesien so sei wie sie selbst: Sieger über die Vergangenheit."
Jetzt will sie heim, ist voller Sehnsucht, und sie hofft,
dass Indonesien so sei wie sie selbst: Sieger über die Vergangenheit."
Denny J.A.s Idee, ein aktuelles, gesellschaftliches Thema in einem Gedicht darzustellen, das dann durch alle massenwirksamen Medien dekliniert wird, ist ein origineller Ansatz gerade in einem Land, in dem das Bildungssystem es nicht allen Bürgern möglich macht, ein Gespür für Lyrik zu entwickeln.
"Die Umfragen sagen mir, dass 67 Prozent der Menschen die Künste lieben; nicht nur Gedichte, sondern auch Filme oder Musik. Wenn man also eine Kampagne auflegt, bei der man so viele Menschen wie möglich erreichen will, kann man das mit der ganzen Bandbreite der Künste machen."
Und das ist sicher ein Grundgedanke des Erzählens: Möglichst viele Menschen zu erreichen. Und je nach Geschmack, nach Vorbildung und Vorlieben, reagiert der eine auf das geschriebene Wort, der andere auf ein Bild, auf Musik oder Comic, auf Gesang oder Dialog.
Virtuelle Realität, elektronisch erlebt
In den Internet-Ausgaben von Zeitungen ist die Mischung aus Text und Foto, Video und Graphik, Links zu weiteren Seiten und Fragen an den Leser längst alltäglich: Warum sollte sich die Literatur diesen Konsumgewohnheiten verweigern?
Auf meiner Reise durch Gegenwart und Zukunft des Erzählens bin ich wieder in Amsterdam. In einer zweistöckigen Bibliothek mit tausenden Büchern bekomme ich eine großrahmige VR-Brille aufgesetzt, unförmig wie eine Taucherbrille, und dazu noch klobige Kopfhörer. VR, also virtuelle Realität, ist das eigentliche Lebenselixier der erzählenden Literatur. Erzählen erfindet Welten. Und das werde ich jetzt nicht nur lesen, sondern auch elektronisch erleben.

Der Autor unterwegs in neuen Lesewelten© Foto: privat
Ich, der Leser, bin mit meinen Seh- und Hör-Sinnen von der Außenwelt abgeschnitten und nehme nur noch wahr, was mir Bildschirm und Kopfhörer übermitteln. Damit ich mich bewegen kann, liefert mir eine kleine Kamera einen schmalen Ausschnitt meiner Umgebung. Eine freundliche Helferin ergreift meinen Arm und führt mich sicher in einen Garten.
Da stehe ich nun. Die Brille engt mein Sehfeld ein. Wann immer ich wissen will, was rechts oder links von mir geschieht, muss ich den Kopf, besser noch, den Oberkörper drehen.
Dann plötzlich verschwindet das Bild meiner Außenwelt, die Performance beginnt: "Die Seele an ihrem Platz" heißt sie.
Nach und nach, mit schwingenden Kopfbewegungen, erkenne ich, dass ich in einer Art schwarzem Ballon stehe. Blicke ich nach unten, sehe ich weiße Zeilen aufsteigen, die aus einer Quelle irgendwo zu meinen Füßen kommen.
"Jemand springt aus dem Fenster seines Hotels.
Er fällt in einen Baum.
Sein Körper wird erst im Herbst, als die Blätter fallen, gefunden."
Er fällt in einen Baum.
Sein Körper wird erst im Herbst, als die Blätter fallen, gefunden."
Mein Kopf nickt auf und ab und hin und her, um den aufsteigenden Zeilen folgen zu können. Mir wird deutlich: Es geht um Todesfälle im Fallen. Es gibt keinen durchkomponierten Text, sondern einzelne Sätze umreißen das Thema.
Schlagartig endet mein Aufenthalt im Ballon, ich bin in einer Filmsequenz:
(Frau) "Da. Da schauen sie. Unten. Da unten."
Offensichtlich stehe ich auf einem Balkon in einer gutbürgerlichen Siedlung. Ich sehe vor mir einen Mann um die fünfzig, der am Balkongeländer steht und hinunter ruft:
"Können Sie sehen, was da passiert ist? Ist es ein Mann oder eine Frau?"
Ich wende den Kopf nach links und sehe auf dem gegenüberliegenden Balkon und unten im Garten Menschen, die irgendwas machen. Sofort wird mir klar, dass hier jemand vom Balkon gestürzt ist, ein Tod, der eben untersucht wird.
Der Unbekannte spricht mich an. Er streckt mir seine Hand entgegen, die ich aber nicht nehme – schließlich ist er ja nur eine Filmfigur.
Aber ich folge dem Mann zum Ende des Balkons. Er bietet mir einen Stuhl an. Es könnte sein, dass ich mich setze.
Dann gleitet abrupt und unaufhaltsam meine virtuelles Ich über die Balkonbrüstung und wird, wie von Kräften gezogen, in den Garten gerissen. Drei Stockwerke tief. Unten stehe ich und der Mann vom Balkon spricht zu mir:
"Wir sind kurz, wir sind an das kurze Leben gebunden."
Während ich versuche, den Vorfall und die Sätze des Mannes zu begreifen, verschwindet der Film vom Bildschirm und ich stehe wieder im schwarzen Ballon.
Zu meinen Füßen steigen neue Texte auf, die sich mit dem Stürzen und dem Steigen befassen, dem Auf und Ab von Börsenkursen beispielsweise.
Zu meinen Füßen steigen neue Texte auf, die sich mit dem Stürzen und dem Steigen befassen, dem Auf und Ab von Börsenkursen beispielsweise.
"Wenn der Körper fällt, bleibt die Seele an ihrem Platz.
was fällt, ist das Los
das Los fällt
was fällt, ist das Los
Krokus
Fallschirm
Lichtschalter
das Gegenteil ist die Beruhigung
welch eine Beruhigung: Es gibt auch das Gegenteil"
was fällt, ist das Los
das Los fällt
was fällt, ist das Los
Krokus
Fallschirm
Lichtschalter
das Gegenteil ist die Beruhigung
welch eine Beruhigung: Es gibt auch das Gegenteil"
Als ich die VR-Brille und die dichten Kopfhörer wieder absetze, erklärt mir meine freundliche Helferin, dass sie mir- als ich aufgefordert wurde, mich zu setzen -einen Stuhl untergeschoben hat. Ich habe mich tatsächlich gesetzt. Als dann mein Absturz in den Garten begann, hat sie mich auf dem Stuhl sitzend einen Meter oder zwei nach vorn geschoben.
Mein Gehirn konnte offensichtlich nicht zwischen den Sinneseindrücken unterscheiden: Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe gelesen. Aber auch die Einwirkungen durch die Assistentin wurden gleichsam in die virtuelle Realität eingespeist. Alles wurde eins.
Allein standen nur die Texte, die mir aus dem brodelnden Chaos der Sinneseindrücke von Augen und Ohren herausgeholfen haben.
Zu Besuch bei Tonnus Osterhoff
"Das ist großartig. Das ist besser, als ich erwartet hatte, denn das bedeutet, dass Literatur einen beruhigenden und erlösenden Aspekt hat."
Tonnus Osterhoff, ein freundlicher älterer Herr, ist holländischer Schriftsteller. Von ihm stammen die Texte und zu Teilen auch die Konzeption der Performance. Ich frage ihn, ob nicht das Wissen, dass ich den Text gleichsam aus der Bewegung, mit dem gesamten Körper aufnehmen muss, sein Schreiben beeinflusst hat.
"Das hat meinen Ansatz nicht verändert. Es gibt in diesem Film ein starkes Element von Vertikalität, in dem letzten Teil des Filmes stürzt man sogar hinab. Aber man ist darauf vorbereitet, weil man die ganze Zeit schon auf und ab geschaut hat und auch der Text handelt vom Fallen und Stürzen."
Wo ich widersprechen möchte: Für mich war der unvorbereitete virtuelle Sturz in den virtuellen Garten nervenaufreibender als alle meine gut geplanten Sprünge mit einem realen Fallschirm auf eine reale Wiese. Ich erwähne, dass mir am Ende die Wörter in dem schwarzen Ballon geholfen haben, mich nach dieser aufwühlenden Erfahrung wieder zurecht zu finden.
Tonnus Osterhoff: "Genau das haben wir versucht haben zu erreichen. Und ich habe von anderen Menschen gehört, die diese Erfahrung auch durchlebt haben, dass der Text am Ende viel organischer aufgenommen wird als beim ersten Lesen am Anfang."
Was wäre, stelle ich mich vor, wenn man in dieser unentrinnbar emotionalen Performance aus Text, Bild und Geräusch und Dialog im geschlossenen System der virtuellen Realität nicht ein todesnahes Szenario erleben würde, sondern eine hocherotische Liebes-Geschichte oder einen schweißtreibenden Actionkrimi mit rasanter Flucht durch die Straßen von Berlin, verfolgt von Terroristen mit einer Kalaschnikow? Man wäre am Ende ganz sicher für jedes Wort dankbar.

Das Laptop-Paradies: das Café St. Oberholz in Berlin-Mitte© dpa / picture alliance / Kay Nietfeld
Ich bin in Berlin. Dorothea Martin ist bei Oolipo head of content, sie verwaltet die Geschichten:
"Oolipo ist eine Plattform für mobiles storytelling. Unsere Besonderheit ist es, dass wir uns dem nativen storytelling verschrieben haben, das heißt, es ist nicht einfach nur mobil, sondern es nutzt die nativen Fähigkeiten, die so ein Smartphone mitbringt."
Wir sitzen im St. Oberholz, einem Internetcafé in Berlin Mitte. Hier arbeitet die digitale Generation, zu deren nativen, von Geburt an zugehörigen Organen neben Augen, Armen, Beinen auch das Smartphone gehört. Es wird getippt, aber nicht geredet. Wenn jemand spricht, dann skypt er. Oder er stellt Fragen nach Oolipo, zum Beispiel an Johannes Conrady, den Chef nämlich: Sitzt hier, hinter Smartphones und Tablets, seine Zielgruppe?
"Diese Zielgruppe liest eigentlich sehr viel. Nur einerseits geht sie zum Teil zurück, das sieht man gerade in Amerika, den Trend, zum gedruckten Buch, weil einfach die Art des Lesens oder des Konsums von Entertainment ganz anders ist als über das Smartphone. Auch auf dem Smartphone wird von der Zielgruppe viel gelesen, das sind halt Dinge wie Facebook-feeds, Twitternachrichten, Blogs, Kurzinhalte, teilweise auch in einer sehr langen Zeit, nur die Darreichungsform ist nicht, ich sag mal, monolithisch, sondern, ich sag mal, fragmentierter."
Alltägliche Literatur-Häppchen
Ich lerne: Das Buch wird bleiben, aber das Smartphone liegt auch auf dem Tisch. Literatur wird beweglich, nicht allein als Puzzle oder als Spiel auf kleinen Displays, sondern als erzählte Geschichte. Allerdings kommt sie in kleinen Häppchen, passgerecht zur alltäglichen Häppchen-Nutzung des Smartphones mit Telefonieren, WhatsApp-Nachrichten, SMSen und den Kurzfilmchen der Tagesschau-App. Aber es geht noch weiter.
Dorothea Martin: "Wenn wir jetzt hier zum Beispiel 'Jellybone' nehmen, das ist eine Geschichte von Kate Pullinger, die in crossmedialen, transmedialen Kreisen recht bekannt ist, die hat für uns speziell eine Geschichte geschrieben über eine junge Frau, die Nachrichten von toten Menschen bekommt. Und diese Nachrichten bekommt man dann auch selbst auf dem Telefon, das heißt, hier wird mit einer Metaebene gespielt, die versucht, den Leser oder die Leserin noch tiefer in die Geschichte hineinzuziehen."
Ich finde die Vorstellung, dass mich als Leser eine tote Frau anruft, einigermaßen erschreckend. Aber ich bin mit meinen Befürchtungen der Entwicklung voraus. Sie ruft nicht an. Noch nicht.
Dorothea Martin: "Angerufen noch nicht, das wäre ein optionales Feature, mit dem wir im Moment noch nicht arbeiten. Aber Sie bekommen push-net-notification, das ist die Funktion, wenn Sie sich die App runterladen, werden Sie gefragt, ob Sie zustimmen, dass Oolipo ihnen Meldungen senden darf und wenn sie dann auf Erlauben klicken, bekommen sie regelmäßig aus den Geschichten raus Nachrichten zugesendet. Und bei 'Jellybone' wären das dann auch zum Teil Nachrichten von vermeintlich oder auch wirklich toten Leuten."
Vielleicht ist das die Zukunft des Erzählens. Die Erzählung geht in die Breite, nahezu alles ist möglich. Der zukünftige Leser liest multimedial."
"Der Text erscheint auf einem dunkeln, lesefreundlichen Hintergrund."
Es wird erzählt, dass die Protagonistin ein Lokal betritt –
"wie im Hörspiel hört man die Geräusche."
Ihr neuer Freund betritt das Lokal…
"er erscheint im Video."
Der Freund macht sich heimliche Gedanken -
"sie erscheinen als Sprechblasen in den graphics."
Die Protagonistin schickt ein Selfie mit ihrem neuen Freund – es erscheint auf meinem Instagram-Account.
Es wird erzählt, dass die Protagonistin ein Lokal betritt –
"wie im Hörspiel hört man die Geräusche."
Ihr neuer Freund betritt das Lokal…
"er erscheint im Video."
Der Freund macht sich heimliche Gedanken -
"sie erscheinen als Sprechblasen in den graphics."
Die Protagonistin schickt ein Selfie mit ihrem neuen Freund – es erscheint auf meinem Instagram-Account.
Johannes Conrady: "Der Medienmix ist eine Sache, da muss man sagen, wir versuchen jetzt, alle Bestandteile: Video, Hintergrundbilder, animierte Bilder, Geräusche, nur Text zu mischen und einfach herauszufinden, was die Kunden denn wirklich nutzen. Da sind wir relativ uneitel, wir mischen jetzt einfach mal alles und was am Ende mehr genutzt wird, darauf werden wir mehr Gewicht legen."
Displays wischen statt Seiten blättern – das allein wird nicht zu Zukunft sein. Natürlich bleiben die Bücher, was sie sind – dick oder schlank, je nach Geschmack - liebenswürdige Begleiter für lange Abendstunden oder kurzweilige Vergnügungen. Bedrucktes Papier zwischen Pappdeckeln allerdings wird nicht länger allein den Markt der Geschichten beherrschen.
Die Welt ist heute viel stärker bildorientiert als noch vor zwanzig oder zehn Jahren. Darin wird die Literatur ihre Chancen sehen. Andere Medien bieten sich an − Musik, Malerei, Animation, Foto, Video, Spiele: Wenn es hilft, werden sich die Geschichten dort neue Unterstützer suchen. Und sehen, was geht. Um das zu erreichen, wozu sie da sind: den Leser, die Leserin lustvoll zu unterhalten.