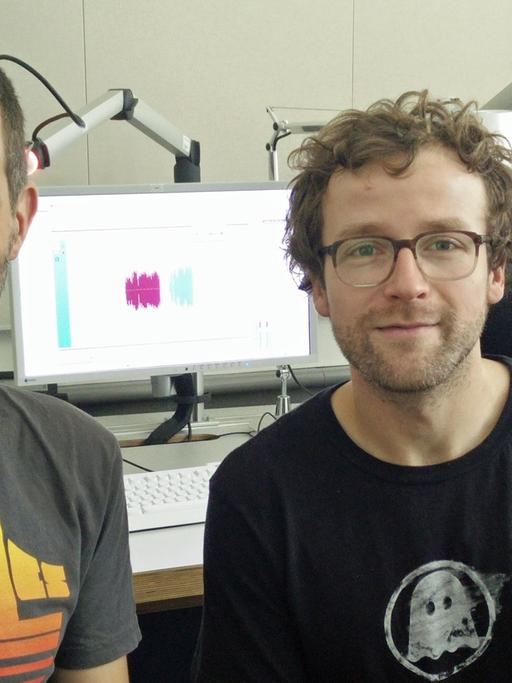Zwiespältige Bilanz des Branchentreffs

Von Tobi Müller · 07.09.2014
Einige Teilnehmer der Berlin Music Week erweckten den Eindruck, als ginge es nicht nur der Plattenindustrie, sondern auch den Künstlern zunehmend besser. Ein Musiker fiel aus der Reihe und wetterte gegen die "stockreaktionäre Musikindustrie".
Es ist schon irre genug, wie an jedem Wochenende der Bär steppt im riesigen Partydreieck zwischen Herrmannplatz (Neukölln), Kottbusser Tor (Kreuzberg) und Frankfurter Tor (Friedrichshain). Wer nachts lieber Radio hört, statt auszugehen, kann sich das auch tagsüber ansehen, vor Sonntagnachmittag gehen die wenigsten nach Hause oder auch: zum Flughafen.
Ständiger Ausnahmezustand
Wenn dann gleichzeitig noch die Berlin Music Week mit dem Berlin Festival zu Ende geht, verdichtet sich das Gefühl von Ausnahmezustand noch einmal. Tankstellen werden okkupiert von Erschöpften, die sich mit frischen Getränken eindecken, die Autos können warten. Trinken gegen den Klimawandel. Oder Umfallen für die Wirtschaft, boomendes Berliner Geschäftsmodell: der Krankenwagen, die Malteser freut's.
Das Bild der Erschöpfung in Massen entspricht sowohl Teilen der Stadt Berlin wie auch der Musikindustrie. Es geht nicht weiter so, aber wir lassen uns die Laune noch lange nicht verderben. Feiern ist schließlich auch Arbeit. Auch wenn das jetzt alles anders ist, wie der nach Dieter Gorny zweitälteste Musikexperte Deutschlands und wenn nicht jüngster, dann sicher ungewöhnlichster Kulturchef einer großen Stadt, Tim Renner, nicht müde wurde zu betonen. Berlin sei auf dem Weg der Gesundung, wie die Musikwirtschaft auf, so Renner.
Die Stadt der Startups
Für Berlin stimmt das wohl, und doch erinnerte Renner in seiner Eröffnungsrede der Konferenz daran, dass man jetzt aufpassen müsse, dass die Grundlage dieser Gesundung nicht sofort wieder verschwinde. Damit meinte er: die Kreativen, die Künstler. Dass die wenig innerstädtischen Raum mehr finden, ist auch eine Folge der Regierung Wowereit, respektive entspricht dem strukturellen Kampf zwischen dem Finanzsenat, der seine Immobilien gerne an den Meistbietenden verkauft und dem die soziale Mischung relativ egal zu sein scheint, und dem Kulturstaatssekrerät, also Renner, der ein Interesse daran hat, dass Berlins Kreativszene nicht austrocknet.
Wie lange die Engführung Berlin und Musikindustrie trägt, ist eine andere Frage. Berlin ist die Stadt der Startups, der hoffnungsvollen Geschäftsideen. Die Deals schließt man woanders ab, für die großen Musikirmen ist die Hauptstadt eher ein Schaufenster. Das sah man auch der Berlin Music Week an: Hippe Jungunternehmer mischten sich von Mitte letzter Woche bis gestern Montag früh mit dem schick tätowierten Festivalvolk. Es gab eine Konferenz, eine Nachwuchsschiene und ein Publikumfestival an der Spree. Ein dreifacher Ausnahmezustand: Das krisenhafte Business, die Horden junger Bands ohne Außicht auf Brot und das Bild der erschöpften Körper, als am Sonntag die Verfeierten dazukamen. Wenn man ein paar Tage wartet, sieht zuviel Hoffnung wie Verzweiflung aus.
Wütende Altstars
Der Zorn kam von den Senioren: Polternd eröffnete der Zürcher Dieter Meier (Yello) das Konferenzprogramm. Meier schimpfte über die "stockreaktionäre Musikindustrie", welche die Künstler erneut "über den Tisch ziehe". Damit meinte er Streamingdienste wie Spotify, bei denen man mit oder ohne Gebühr Zugriff auf riesige Archive hat. Dabei verdienen die Musiker fast nichts. Die Zahlen wechselten in Meiers Ausbrüchen, weshalb die Berliner Zeitung ihn einen "Schweizer Dampfplauderer" nannte. Meier hat nicht das Zeug zum Steuerberater, schon richtig. Auch richtig: Die "Gesundung der Industrie", wie sie der Musikguru und neue Berliner Kulturchef Tim Renner diagnostiziert, kommt unten nicht an. Oben sind Firmen, unten Künstler. Dagegen darf man auch mal poltern.
Streamingmodelle sind zartche Pflänzchen, und sie lenken zu sehr ab von der eigentlichen Problemzone: Der mit Abstand größte Streamingdienst ist nach wie vor Youtube, und da verdienen Künstler noch weniger. Youtube, und damit Google, trifft die Hauptschuld, wenn es um den Zusammenbruch des musikalischen Mittelstandes geht. Dass in diese Lücke viele Popkünstlerinnen springen, ist eine Art sexistische Pointe: Wenn es den Männern zu eng wird, dürfen die Frauen endlich nachrücken. Aber Achtung, Damen wie Jessie Ware sind auf dem Sprung, Whitney Houston zu beerben. Man merkt es auch der Musik und sogar den Ansagen an:
"Oh Gott, vor einer Woche habe ich geheiratet, it was lovely, und der nächste Song handelt davon, warum er so verfickt lange brauchte, um mir den Antrag zu machen."
Festival als Verlustgeschäft
Für Frauen wie Männer gilt aber das gleiche, sowohl auf Künstler- wie Festivalseite: Das Konzertgeschäft kann den Niedergang des Tonträgerverkaufs nicht auffangen. Das Berlin Festival musste vom schönen, weiten ehemaligen Flughafen Tempelhof in das Gelände rund um die Arena umziehen. Klar kann man das als Konzentration verkaufen, als Party, die nicht aufhört. Im Kern geht es aber um ein Verlustgeschäft, um Redimensionierung, um Abzahlen von Defiziten, was im Pressemitteilungssprech so klingt:
"Mit dem Erfolg der diesjährigen Ausgabe sind wir unserem Zukunftsplan für das Berlin Festival einen großen Schritt näher gekommen."
Die Zukunft ist also nah, das ist immerhin beruhigend. Ungewiss bleibt, ob die Dauerpartystadt Berlin ein so großes Festival verträgt, das sich um ein gutes Programm jenseits der ganz, ganz großen Kracher bemüht. Oder ob man mit Ticketpreisen für drei Tage, die man anderswo schon in zwei Stunden auf den Tresen haut, Bands bezahlen kann, die, wenn überhaupt, nur noch live etwas verdienen können.